Treffpunkt Sommer. Englischer Garten, München. Foto: Martin Siepmann/ImageBROKER/Picture Alliance
Lange bekamen Kinder und Jugendliche wenig Aufmerksamkeit, dann galten sie als potenzielle Treiber der Pandemie. Doch wie es ihnen unter Corona geht, wie sie mit der Isolation klarkommen – das war bislang kein großes Thema. Mittlerweile aber sehen manche Fachleute im Schatten der Krise eine „verlorene Generation“ heranwachsen. Szenarien für eine Jugend nach dem Lockdown.
Was ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland mit Corona dramatisch anders geworden?
Sabine Walper: Im Verlauf der Pandemie mit den anhaltenden Kontaktbeschränkungen haben sich Kinder und Jugendliche zunehmend einsam gefühlt. Viele Studien und auch unsere eigenen Daten zeigen, wie stark sie das psychisch belastete. Kontakte zu Gleichaltrigen zu haben, ist besonders für Jugendliche zentral. Sich selbst zu positionieren, seine Rolle zu finden, zu erkennen, wer man ist und wer nicht, dafür brauchen Jugendliche den direkten Austausch mit Gleichaltrigen. Das ist ganz entscheidend, um im sozialen Bereich und bei der Entwicklung der Persönlichkeit voranzukommen. Und genau da gab es einen dramatischen Einschnitt.
Gerd Schulte-Körne: Wir sprechen immer von den Jugendlichen und den Kindern, aber das ist natürlich keine homogene Gruppe. Ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen ist mit der Krise gut zurechtgekommen. Aber nicht wenigen ging es richtig schlecht. Das sind nicht nur die, die schon vor Corona psychisch krank waren. Besonders betroffen waren Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, die in engen Wohnungen leben, die keine Ressourcen haben. Die haben sich vor der Krise gerade noch über Wasser halten können, waren dann aber mit der Situation des Homeschoolings komplett überfordert. Viele Eltern, die wahrscheinlich sonst nie in die Klinik gekommen wären, waren bei uns und haben gesagt: Wir schaffen das nicht mehr. Familien, die kein Geld haben, um ihre Kinder zuhause zu unterstützen, Familien, bei denen beide Eltern arbeiten müssen und niemand die Kinder daheim betreuen kann. Diese Kinder und Jugendlichen saßen dann eben den ganzen Tag vor dem Fernsehen oder dem Rechner. Sie hatten nicht genug Bewegung, bekamen keine Bildung und hatten weder soziale noch körperliche Kontakte.
Lässt sich sagen, wie groß diese Gruppen waren?
Schulte-Körne: Man geht Studien zufolge davon aus, dass normalerweise zwischen acht und zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen wegen psychischer Probleme behandlungsbedürftig sind. Diese Werte sind unter Corona auf zwölf bis 14 Prozent angestiegen.

Das Jugendalter als Entwicklungsphase unterschätzt
Gibt es denn Rückmeldungen, wie Jugendliche insgesamt diese Zeit empfunden haben?
Walper: Aus den Befragungen wissen wir, dass sich der Großteil der Jugendlichen nicht gehört fühlte. Die Jugendlichen machen der Politik Vorwürfe, komplett ausgeblendet zu haben, wie es für sie im Lockdown eigentlich war. Es ist viel über die Arbeitsteilung in Familien diskutiert worden und darüber, ob wir gerade ein Rollback in die 1950er erleben. Es ist auch intensiv über Kleinkinder und deren Betreuungssituation gesprochen worden. Und die Jugendlichen? Die kamen ganz zum Schluss. Es war, als müsste diese Altersgruppe alleine klarkommen.
Wieso?
Walper: Es wird völlig unterschätzt, wie wichtig das Jugendalter als Entwicklungsphase ist und welche Bedürfnisse Jugendliche haben. Nicht nur die Familien gingen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den Lockdown, sondern auch die Jugendlichen selbst. Gerade manche Stärken haben sie in der Zeit der Pandemie auch verletzlicher gemacht. So sehen wir einen deutlichen Anstieg der Depressivität bei Jugendlichen. Es traf gerade auch Gesellige, Extrovertierte, die normalerweise ihr soziales Netzwerk haben und gut zurechtkommen. Aber genau in diesem Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein und enge Beziehungen zu haben, waren und sind sie in der Pandemie von ihrer Welt abgeschnitten.
Frenzel: Jugendliche wurden nicht nur bis heute nicht gefragt nach ihren Bedürfnissen. Sie unterliegen ja faktisch auch härteren Regeln als viele andere Bevölkerungsgruppen. Selbst während der Lockdown-Phasen gab es Ausnahmen für jede Menge Arbeitnehmer – aber keine für Schüler. Schulen und – nebenbei bemerkt – auch Universitäten zuzusperren, war politisch offenbar leichter durchsetzbar.
Der Aufbruch in die Autonomie – blockiert
Pubertät und Jugendalter sind die Phase, in der man sich von den Eltern absetzt. In der Pandemie aber waren Eltern und Kinder zusammengezwungen. Mit welchen Folgen?
Walper: Das Klima in der Familie ist enorm wichtig. Wie kommen die Eltern miteinander klar, wie ist ihr Erziehungsverhalten? Dort, wo sich das Klima deutlich
verschlechterte und es mehr Stress und Ängstlichkeit gab, gar nicht mal die großen Konflikte, hat das auch die Jugendlichen nicht unberührt gelassen. Zudem war die so wichtige Außenorientierung kaum möglich. Erste tastende Liebesbeziehungen etwa sind oft schnell wieder durch, wenn sich die Jugendlichen ein paar Wochen nicht sehen und nicht anfassen können. Dieser ganze Bereich der romantischen Entwicklung lag mehr oder minder brach.
Schulte-Körne: Die gesamte Autonomieentwicklung war in dieser Zeit massiv gestört. In der Klinik ist es eines der wichtigen Therapieziele, Jugendliche, die da Schwierigkeiten haben, zu fördern. Gerade bei den jungen Männern haben wir enorme Spannungen bemerkt. Sie waren wütend und fragten sich: Wer interessiert sich eigentlich für uns? Wer schert sich um unsere ganz normalen Bedürfnisse? Wir werden als diejenigen hingestellt, die die Regeln brechen.
Und die Jüngeren?
Schulte-Körne: Die haben ja oft auch eine Menge mitgemacht in ihrer emotionalen Entwicklung. Wie sollten sie lernen, plötzlich mit Ängsten umzugehen, die sie zuvor meist nicht gekannt hatten? Wenn beispielsweise die Großeltern erkrankt waren und die Kinder nicht ins Krankenhaus durften, um sie zu besuchen. Das konnten sie nicht begreifen. Also musste man mit ihnen daran arbeiten zu verstehen, dass vielleicht auch ein geliebter Mensch stirbt, den sie nicht mehr sehen können. Das hat sie extrem belastet und mitunter dazu geführt, dass eine normale Trauerreaktion zu einer schweren Depression wurde, die psychotherapeutisch behandelt werden musste. Da war stilles Leiden in den Familien. Alle haben sich nur für die Corona-Maßnahmen interessiert, aber was da in Einzelfällen in den Familien los war, ist untergegangen.
Was ist da konkret übersehen worden?
Schulte-Körne: Sicher, viele Familien haben die Belastungen einigermaßen kompensieren und den Alltag neu strukturieren können. Andere Familien sind daran gescheitert. Zum Teil haben die Eltern ihre Jobs verloren, sie waren dann auch existenziell bedroht. Welchen emotionalen Belastungen Familien in dieser Zeit ausgesetzt waren, davon erzählen die Daten. Zum Beispiel hat bei Erwachsenen der Konsum von legalen, aber auch von illegalen Substanzen in der Coronakrise deutlich zugenommen. Die Gewalt in den Familien hat stark zugenommen und damit die Gefährdungen des Kindeswohls. Wir haben in der Klinik auch an anderer Stelle gemerkt, wie die Versorgung von Kindern nicht mehr geklappt hat. Wenn wir Kinder und Jugendliche entlassen, gehen sie oft in Einrichtungen der Jugendhilfe, dem für die nächsten Schritte geeigneten therapeutischen Setting. Doch unter Corona hat die Jugendhilfe signalisiert, sie könne niemanden aufnehmen. Wir mussten die Kinder dann in die zuvor schon überforderten Familien zurückentlassen. Dies hat nicht selten dazu geführt, dass die Kinder nach kurzer Zeit wieder stationär behandelt werden mussten.

Das strapazierte Gerechtigkeitsgefühl
Auf der einen Seite fühlen sie sich nicht gehört, auf der anderen nimmt man sie für vieles in die Pflicht, was wir Erwachsenen nicht geschafft haben. Und jetzt sollen sie auch noch die Impfquote retten. Was macht das mit dem Gerechtigkeitsgefühl der Jugendlichen?
Walper: Als die Maßnahmen gelockert wurden, hatte man schon das Gefühl, der Dampfdeckel geht hoch. Da hat sich enormer Druck entladen. Auf den Straßen wie etwa in der Münchner Türkenstraße war schon viel los, die Jugendlichen sind über Autos gesprungen, überall lagen Müll und zerbrochene Flaschen. Das scheint sich jetzt wieder etwas gelegt zu haben.
Schulte-Körne: Wobei die Wut sicher zum Teil Ausdruck einer Verzweiflung, einer emotionalen Krise war. Viele Jugendliche sind vor allen Dingen unter Stress geraten, weil sie gemerkt haben, dass sie auch in der Schule abgehängt sind. In unsere Sprechstunde kommen jetzt zunehmend Jugendliche, die verzweifelt sind, weil der Notendruck wieder da ist.
Gibt es auch Faktoren, die Kinder und Jugendliche resilienter gemacht haben?
Frenzel: Es gibt qualitative Daten, dass sich gewisse Werte sich für die Jugendlichen herauskristallisiert haben. Sie wissen genauer, wer ein guter verlässlicher Freund ist, zu dem man eben trotz Einschränkungen den Kontakt halten konnte. Sie erkennen, dass Schule ein Ort ist, an den man auch gerne kommen kann, weil man da Gleichgesinnte Menschen trifft. Das war für alle derart selbstverständlich, dass sie erst in der Krise lernten, das überhaupt zu schätzen. Also: Die Schülerinnen und Schüler sind zwar jetzt mit den Lerndefiziten aus der Coronazeit konfrontiert. Aber vielleicht haben sie aus der Zeit des Lockdowns Schule auch anders zu sehen gelernt.
Inwiefern?
Frenzel: Zugespitzt formuliert hatte Schule in der Coronazeit etwas von Reformpädagogik. Im Homeschooling sind die Leistungsanforderungen fast auf null gegangen. Es wurden keine Noten mehr vergeben. Die Lernkontexte waren viel offener, es wurde von den Schülerinnen und Schülern erwartet, dass sie sich selbst organisieren; das wurde ihnen aber auch zugetraut und zugestanden. Und in der neuen Situation, die schockartig hereingebrochen war, hat mitunter fast eine Verbrüderung, auf jeden Fall ein Zusammenrücken von Lehrenden und Lernenden stattgefunden – gegen einen äußeren Feind, das Virus. Schule und Lernen war in Zügen so, wie manche Reformer es sich wünschen: ein Angebot von Lerninhalten, die gemeinsam und mit viel Autonomie-Spielraum erarbeitet werden.
Das klingt doch gut.
Frenzel: Das Problem ist nur, dass Schule bis dahin gänzlich anders funktioniert hat – keine Lernangebote, sondern Vorgaben von Wissensinhalten, welche in der nächsten Schulaufgabe abgeprüft werden; unter dauernder Androhung schlechter Noten. Angesichts dessen hat es im Homeschooling bei vielen Schülerinnen und Schülern erstaunlich gut mit der Selbstregulation geklappt, das ließe sich tatsächlich als Ressource verbuchen.
Die ganz reale virtuelle Welt
Viele Jugendliche haben sich in der Zeit des Lockdowns zum Teil gut in der digitalen Welt eingerichtet und dort ihre Netzwerke genutzt und erweitert. Die Internetnutzung ist ja unter Erwachsenen immer eher kritisch konnotiert. Fällt das Urteil jetzt milder aus?
Walper: Das gehörte zu den wenigen Möglichkeiten, Kontakte zu halten, sich zuhause zu beschäftigen und auch zu lernen, die einem offenstanden. Und das ist ja auch besser als gar nichts. Von daher haben wir alle einen starken Digitalisierungsschub erlebt, nicht nur die Schulen, die teils immer noch hinterherhinken. Gerade für die Jugendlichen war das Netz natürlich ein wichtiges Medium. Dass sie damit alles kompensieren konnten, glaube ich aber eher nicht.
Schulte-Körne: Sie waren schon vorher extrem gut vernetzt. Die Ausstattung mit Smartphones und die Zeit, die Kinder und Jugendliche im Netz verbringen, nimmt stetig zu. Die durchschnittliche Nutzungszeit bei Grundschulkindern lag letztens bei 3,5 Stunden pro Tag, bei Grundschulkindern!
Aber ist es nicht eine vitale Reaktion auf das Abgeschiedensein, wenn Jugendliche abends im Netz unterwegs sind und dabei nicht nur zocken, sondern auch Plattformen zum Chatten haben?
Schulte-Körne: Der unaufhaltsame Boom der sozialen Medien – entschuldigen Sie die klinische Brille, die ich jetzt wieder aufsetze – ist auch mit mehr Cybermobbing verbunden. Es gibt noch keine Daten, ob sich das in der Coronazeit noch verstärkt hat. Die Chance, sich sozial zu vernetzen, könnte auch das Risiko erhöht haben, Mobbing ausgesetzt zu sein. Und in der Pandemie konnten sich Betroffene erst recht nicht wehren, weil das Netz die einzige Form des Austausches bot.
Als Erwachsene sind wir gewohnt zu sagen, Face-to-face-Kontakt ist gut und digitaler Kontakt ist bestenfalls Ersatz. Aber stimmt für die Jugendlichen diese Trennung zwischen realer und digitaler überhaupt noch, ganz abgesehen von der Wertung? Wächst da nicht eher zusammen, was für sie zusammengehört?
Walper: Für Jugendliche gehört tatsächlich beides dazu. Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, die nicht auch online mit ihren Freunden unterwegs ist. Es ist für sie gerade dieses Zusammenspiel von Präsenz und digitalen Kontakten, der schnelle Austausch von kurzen Nachrichten. Allein das frei fließende Hin- und Her, bis eine Verabredung steht, ist ganz normale Kommunikation unter Jugendlichen. Und es haben sich ja viele technische Hilfsmittel für ein virtuelles Zusammensein ausgebildet – vom Spielen bis zum gemeinsamen Serien-Schauen für jedem im eigenen Zimmer.
Schulte-Körne: Ich würde nicht von der einen und der anderen Welt sprechen. Real hat sich das schon längst verändert, wir als Erwachsene hinken da eher hinterher. Die Frage ist nur, was wir aus verschiedener Perspektive empfehlen. Natürlich findet viel Kommunikation im Netz statt, das ist real, aber die persönliche Begegnung ersetzt das einfach nicht, das hat eine andere Qualität und Intensität. Die digitale Welt ist, was die Sensorik angeht, visuell, vielleicht noch auditiv, aber die anderen sensorischen Bereiche werden nicht bedient. Das ist eine Verarmung der Wahrnehmung von Erlebnissen.
Haben wir die Jugendlichen auch im digitalen Raum allein gelassen?
Schulte-Körne: Wir müssten uns tatsächlich viel mehr mit diesen Lebenswelten auseinandersetzen und kompetenter werden. Einfach nur den Stecker zu ziehen, das funktioniert nicht.

Was Schule zu einem sozialen Raum machen kann
Im Netz waren die Jugendlichen im Lockdown viel unterwegs, mit schulischen Dingen aber deutlich weniger beschäftigt als zuvor. Schule ist aber nicht nur ein Ort der Wissensakkumulation, sondern vor allem auch ein sozialer Ort. Wie lässt sich das stärken?
Frenzel: Meines Erachtens stellt sich die Frage so nicht. Denn alle Beobachtungen zeigen mir, dass Schule unter den Jugendlichen gerade eine viel größere Wertschätzung erfährt als sonst. Viele haben sich darauf gefreut, wieder hinzugehen. Und das ist seit Langem mein Mantra: Die Schulen müssen dieser neuen Stimmung unter den Jugendlichen jetzt auch Raum geben, fördern, dass es für sie eine Ressource ist, ein Ort, an dem sie Freunde treffen und mit diesen gemeinsam lernen. Es darf nicht der Ort sein, an dem man stillsitzt, nicht der Ort, an dem nur von Lernrückständen die Rede ist, die es gilt, schnell aufzuholen. Sonst kippt das leicht wieder. Den Lehrkräften geht es doch auch so: Sie sind froh, ihre Schüler wieder vor sich sitzen zu haben und ihnen den Lernstoff nicht mehr nur auf Plattformen hochladen zu müssen.
Schulte-Körne: Will man Schule wirklich zu einem sozialen Raum machen, müsste man sie anders gestalten. Das fängt schon damit an, wie sie gebaut sind. Begegnungsbereiche sind da meist nicht vorgesehen und wenn, dann als kleine Pausenhöfe. Vor allem aber ist der Unterricht nicht als soziale Begegnung gestaltet, sondern vornehmlich dazu da, um in einem strengen Korsett möglichst viel Wissen zu vermitteln. Das ganze Bildungssystem hat ja vor allem das Ziel, für die nächste Ausbildungsphase zu qualifizieren. Es stellt sich aber die Frage, wie sinnvoll es ist, auf Abschlüsse als Bildungsgaranten zu setzen. Dadurch entsteht automatisch enormer Druck.
Walper: Ich glaube, dass wir jetzt die Erfahrungen gemacht haben, dass anders zu unterrichten wirklich gut sein kann für alle Beteiligten. Das simple Schema des Flipped Classroom, das Schülern die Möglichkeit gibt, sich Dinge zunächst selber zu erarbeiten und den Unterricht dann dafür zu nutzen, um darüber zu sprechen. Das wäre ein sozialer Raum, den man da schafft, anders als mit dem klassischen Frontalunterricht. Ich hoffe, dass diese Erfahrungen sich nutzen lassen, um Schule weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir eine gewisse Ruhe. Im Moment beobachte ich aber eine aufgeregte Diskussion um die vielen Lerndefizite und eine vermeintlich verlorene Generation. Das droht eher eine Panik anzuheizen und alte Muster wiederzubeleben.
Frenzel: Meines Erachtens liegen zwei Möglichkeiten auf der Hand. Das eine ist die Ganztagsschule. Schule als sozialen Raum nutzen zu können, ist schlicht auch eine Frage der Zeit, der gemeinsamen Verweildauer. Das andere wäre eine Art Moratorium. Warum können wir nicht die Zeit um mindestens ein halbes Schuljahr zurückdrehen, was den erwarteten Leistungsstand angeht? Das würde einiges an Druck herausnehmen. Zumindest am Gymnasium läge das auf der Hand, man könnte es aber an allen Schularten machen. Es wundert mich, dass das überhaupt nicht in der Diskussion ist.
Schulte-Körne: Die Schule müsste sich auch öffnen. Der Ganztag bietet die Chance, mit anderen Partnern im sozialen Netz zu kooperieren. Gerade in einer Stadt wie München gibt es viele psychosoziale Angebote. Wenn man denen in der Schule Raum gäbe, Angebote zu machen, ließe sich viel erreichen.
Walper: Es gibt einzelne Schulen, die das schon intensiv machen, aber es wäre Zeit für eine breitere Initiative. Wahrscheinlich ist die leichter im Grundschulbereich als in der Sekundarstufe anzusiedeln, da dort jetzt der Ganztagsanspruch gesetzlich verankert ist. Das Land Nordrhein-Westfalen gründet gerade 40 Familiengrundschulzentren, die genau ein solches Konzept verfolgen und die Beratungs- und Elternbildungs- sowie weitere Angebote in die Schulen holen und dort institutionell verankern. Man wird im Ganztag auch die Sportvereine mit hereinholen müssen, weil sonst die Kinder erst abends um acht zum Fußballtraining kommen. Und es braucht gute Konzepte, den Ganztag so zu gliedern, dass es kein pures Lernprogramm from nine to five ist.

„Wir brauchen ein Aufholprogramm in Unbeschwertsein“
Ihre Kritik an einer forcierten Aufholjagd würden die meisten Jugendlichen wahrscheinlich sofort unterschreiben. In einer der Medienumfragen, in denen es um das derzeitige Lebensgefühl von Jugendlichen ging, hat ein Mädchen es so formuliert: „Wir brauchen ein Aufholprogramm in Unbeschwertsein“.
Frenzel: Das brauchen wir wohl alle.
Schulte-Körne: Wohl wahr.
Aber die Jugendlichen haben es zuerst formuliert. Wie könnte denn so etwas aussehen?
Schulte-Körne: Zunächst einmal: den Druck rausnehmen. Man kann nicht alles aufholen, nicht alles kompensieren, was sie versäumt haben. Geringerer Druck bedeutet ein geringeres Stressniveau. Und das ist, denke ich, was die Jugendlichen eigentlich meinen. Die hatten die ganze Zeit Druck, auch in der Coronazeit. Und sie wünschen sich eine Phase, in der der Druck nachlässt, sie wünschen sich, nicht ständig das Gefühl zu haben oder vermittelt zu bekommen, defizitär zu sein und etwas hinterherzuhinken, das man nicht erreichen kann. Man darf nicht vergessen, dass sie erschöpft sind.
Wovon erschöpft?
Schulte-Körne: Wir Erwachsenen können besser vorausahnen, wie es weitergeht. Aber Kinder und Jugendliche waren mit diesem „auf Sicht fahren“ extrem überfordert. Und je jünger die Kinder waren, desto weniger konnten sie absehen, was gleich wieder ihre Lebenswelt umstülpt. Wir wünschen uns doch alle, dass es mit so einer Anspannung vorbei ist. Wenn wir alle nur im Kopf haben, dass wir da anschließen müssen, wo wir vor der Pandemie waren, haben wir nichts gelernt.
Walper: Deshalb finde ich es auch sehr gefährlich, von einer verlorenen Generation zu sprechen. Dann verabschieden wir uns gleich von der Idee, dass Jugendliche auch resilient sein können. Aber der Druck, der aus dem Bildungssystem kommt, ist für viele fatal. Schon im ersten Lockdown hat das Thema Bildung die Jugendlichen am meisten beschäftigt. Selten hatten wir ein Thema, das so übereinstimmend in den offenen Angaben in unseren Fragebögen auftauchte. Für fast die Hälfte der Jugendlichen war das der große Aufreger: Was wird aus mir? Habe ich überhaupt noch eine faire Chance? Und je näher sie an einem Abschluss sind, der in die nächste Bildungsetappe führen soll, desto stärker beschäftigt es sie. Ich glaube, die Kinder- und Jugendarbeit muss dringend wieder an den Start, um den Schülerinnen und Schülern mit ihren Angeboten andere Erfahrungen von Gemeinschaft, Spiel und Kreativität zu vermitteln. Auch da hat vieles brachgelegen. Dass die Kinder- und Jugendhilfe wirklich systemrelevant ist, musste erstmal kommuniziert werden.
Frenzel: Es ist jetzt überall angekommen, dass die Schulen offen bleiben sollten. Es kann schon etwas zu einer neuen Unbeschwertheit beitragen, wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Schulen nicht wieder dichtmachen.
Bevor das Virus kam, gab es ja weltweit in Teilen der Jugend eine enorme Aufbruchstimmung. Fridays for Future zum Beispiel war auf dem Weg zu einer echten Massenbewegung. Dann war notgedrungen Funkstille. Kann jetzt so was wie ein dauerhaft erfolgreicher Restart gelingen? Oder haben wir es – Stichwort Lebensgefühl – nach Corona zwar nicht mit einer verlorenen, aber doch einer verhaltenen Generation zu tun?
Walper: Ja, das wird schon beschrieben, dass es einige Jugendlichen durchaus Überwindung kostet, wieder auf andere unbeschwert zuzugehen. Aber gerade solche Ideen, Themen und Werthaltungen, für die Jugendliche sich engagieren, können die Brücke bilden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Bewegungen und die Auseinandersetzung über politische oder ökologische Themen Jugendliche wieder zusammenbringen und ihnen den nötigen Schwung geben.
Schulte-Körne: Erst einmal muss diese Phase der Depression überwunden werden. Das wird nicht so leicht gelingen. Aber vielleicht ist es auch für die gesamte Gesellschaft nicht so schlecht, wenn sie sich nicht darauf verlassen kann, dass der jugendliche Elan es schon richtet, sondern es angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsame Initiativen bräuchte. Nicht hier die Jugendlichen, dort die Erwachsenen.
Moderation: Hubert Filser und Martin Thurau

Prof. Dr. Anne Frenzel
ist Professorin für Pädagogische Psychologie und Learning Sciences am Department Psychologie der LMU. Frenzel, Jahrgang 1977, studierte Psychologie an der Universität Würzburg und an der LMU. Sie wurde an der LMU promoviert und habilitierte sich auch dort. Sie war als Professorin an der Universität Augsburg in der Lehrerbildung tätig, bevor sie an die LMU zurückkehrte, wo sie nun Akademische Direktorin des Master-Programms „Psychology: Learning Sciences” und Ko-Direktorin der Graduiertenausbildung in den Learning Sciences ist.
Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne
ist Inhaber des Lehrstuhls für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie sowie Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am LMU Klinikum. Schulte-Körne, Jahrgang 1961, studierte Medizin an der RWTH Aachen und der Universität Marburg, Promotion und Habilitation an der Universtität Marburg. Er hat die Website www.ich-bin-alles.de maßgeblich mitentwickelt, die Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern wichtige Informationen zur psychischen Gesundheit und zur Depression gibt.


Prof. Dr. Sabine Walper
ist Direktorin des Deutschen Jugendinstituts (DJI), München, und Professorin für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Jugendforschung an der LMU (beurlaubt). Walper, Jahrgang 1956, hat Psychologie und Pädagogik an der Universität Düsseldorf, an der TU Berlin und an der University of California in Berkeley studiert. Sie wurde an der TU Berlin promoviert und hat sich an der LMU in Psychologie habilitiert. Seit 2012 war sie zunächst Forschungsdirektorin am DJI, bevor sie dort 2021 zur Direktorin berufen wurde. (Foto: Andreas Obermeier)










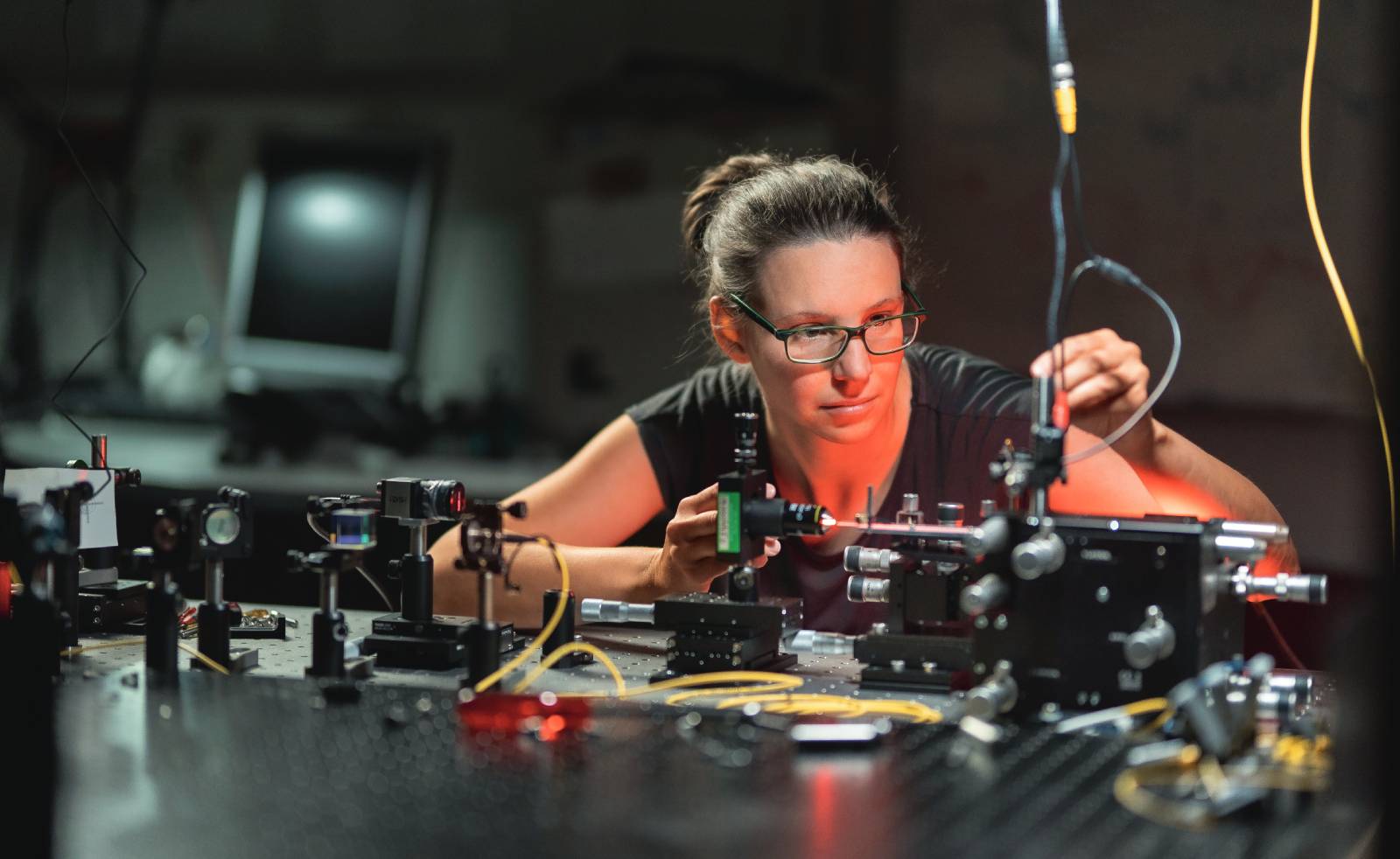










0 Kommentare