Scheitern am System – Hikikomori als Thema im Theater: Toshiki Okada inszenierte sein Stück The Vacuum Cleaner 2019 an den Münchner Kammerspielen. Szene mit Thomas Hauser. Foto: Julian Baumann
Sie hocken in ihren winzigen Zimmern, vor ihren Rechnern, liegen auch tagsüber auf ihren Betten. Nach draußen gehen sie allenfalls nachts, und auch das nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Raus ins Leben? Von wegen. Für diese Jugendlichen spielt sich das Leben auf wenigen Quadratmetern ab. Es ist ein Leben in der selbstverfügten Isolation – monatelang, jahrelang, mitunter jahrzehntelang. Hikikomori heißen sie, das kommt vom japanischen Wort für „sich zurückziehen“. In aller Regel leben sie noch bei ihren Eltern, doch auch mit denen vermeiden sie den Kontakt. In japanischen Fernsehfilmen, so erzählt Evelyn Schulz, reichen längst wenige Bilder, um die Situation für jeden Zuschauer hinreichend zu beschreiben: die geschlossene Zimmertür, vor der die Mutter das Essen abstellt. „Das ist ein fester Topos“.
Allein schon das zeige, sagt die Professorin für Japanologie an der LMU, wie weit verbreitet das Phänomen in Japan ist. Bereits in den 1980er-Jahren, so erinnert sich Schulz, habe ihre damalige Gastfamilie von solchen Fällen berichtet, „von Menschen, die Angst vor der Welt haben, vielleicht depressiv sind, mit diffusen psychischen Anomalien zu kämpfen hatten.“ Mittlerweile gehen Experten allein in Japan von zwischen einer halben und mehr als einer Million Menschen aus, meist sind es Männer, denen auf diese Weise die Welt abhandenkommt. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß keiner zu sagen.
Auch wenn die Forschung mittlerweile annimmt, dass es ähnliche Phänomene womöglich ebenso in anderen Ländern gibt, verblüfft die schiere Zahl der Betroffenen in Japan. Was treibt die jungen Menschen in die Isolation? Was macht den Rückzug zu einer Massenbewegung? Welche Besonderheiten der japanischen Sozialstruktur haben dazu beigetragen? Nach der offiziellen Definition gilt jemand als Hikikomori, der sich länger als sechs Monate von der Welt abschließt. Doch ansonsten sind die Diagnosekriterien alles andere als einheitlich. Die Lebensumstände und die Lebensläufe der Betroffenen sind vielfältig und bilden kein einheitliches Muster. Dysfunktionale Familienstrukturen, Kindheitstraumata, Mobbing-Erfahrungen, gescheiterte Schullaufbahnen, problematische Liebesbeziehungen – unterschiedliche Gründe können zum Auslöser werden. Bei vielen Betroffenen geht der Rückzug mit psychischen Störungen einher. Die Liste der Komorbitäten ist lang: Schizophrenien, Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Störungen aus dem Autismusspektrum. Doch nach wie vor ist in den meisten Fällen nicht wirklich klar, ob sie Ursache oder nicht eher Folge des sozialen Rückzugs sind.
Die Last der richtigen Laufbahn
„In der japanischen Gesellschaft herrschen sehr normative Vorstellungen davon, wie Bildungs- und Erwerbsbiografien auszusehen haben“, skizziert Evelyn Schulz. Und wenn schon viele Eltern nur ein Kind haben, konzentrieren sie gerne alle Wünsche von Wohlstand und Aufstieg eben auf dieses eine Kind und überfordern es mit überzogenen Erwartungen.
„Das Schulsystem ist sehr rigide“, sagt Schulz. „Schule, das ist bis heute so: Die Kinder haben Ganztagsunterricht und abends gehen sie noch einmal zu einer privaten Nachhilfeschule.“ Um auf eine der guten weiterführenden Schulen oder eine angesehene Universität zu kommen, müssen die Jugendlichen harte Tests bestehen. Und anders als etwa in Deutschland, sagt Schulz, gibt es in diesem System nur wenige Rückfallpositionen: Wer es nicht schafft, hat es häufig verspielt.
„Ich habe das bei meinen Besuchen oft gesehen. Wie halten die Kinder das aus, so ohne Freiraum, habe ich mich gefragt.“ Und wo das soziale Biotop eine Monokultur ist, haben es diejenigen schwer, die nicht so gerade wachsen mögen: „Oft ist es gar nicht mal das Scheitern an den schulischen Anforderungen“, sagt Schulz. „Nicht selten passen die jungen Menschen in das System einfach nicht so rein.“
Die gesellschaftlich vorgegebenen Karriereraster sind eng. Schon wer nach dem Hochschulabschluss noch ein Jahr ins Ausland will, riskiert, sich danach nicht mehr in die normierten Lebensläufe einspuren zu können. Lange Zeit galt dieses Funktionieren nach starren Regeln tatsächlich als vielversprechend: Wer sich anstrengt, hieß es, der bringt es zu etwas – eine Art Turbovariante der deutschen Wirtschaftswundermentalität. Und noch immer sind gesellschaftliche Anerkennung und sozialer Status so eng an die geradlinige Karriere gebunden wie in kaum einem anderen Land.
Doch diesem imaginären Geschäftsmodell der Nachkriegszeit fehlt in Zeiten von Globalisierung und postindustriellen Umbrüchen längst die sichere Grundlage. Auch wenn Japan nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und der Yen eine sehr starke Währung – das alte Wohlstandsversprechen gilt nicht mehr. Aus Japan ist eine Gap Society, eine Differenzgesellschaft, geworden, die soziale Schere öffnet sich immer weiter, die Mittelschicht bröckelt.
All das macht es nicht eben einfach, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, wenngleich sich, so Schulz, immer mehr junge Menschen von der starren kollektiven Leistungsethik, von der patriarchalisch organisierten Berufswelt abkehren und andere Formen des Lebens und Arbeitens anstreben. Die einen mögen kleine Startups gründen, die anderen beruflich kürzertreten und nach einer Work-Life-Balance suchen. „Und mittlerweile“, konstatiert Schulz, „zeigen Teile der Gesellschaft auch mehr Verständnis dafür, wenn jemand sagt: Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich komme da nicht mehr mit.“
Schattenexistenz in einer Kultur der Scham
Diese japanische Variante der Verweigerung hat in keiner Form etwas Demonstratives; sie ist gänzlich nach innen gerichtet. Es ist kein lauter Protest, sondern das leise Verschwinden aus der Welt da draußen. In Berichten sprechen Betroffene darüber, dass sie im landläufigen Sinne als „Versager“ gelten, sie sprechen von ihrem schlechten Gewissen, weil sie ihren Eltern immer noch auf der Tasche liegen. Die meisten Hikikomori, sagt Schulz, sehen ihre Situation sehr klar. Sie wissen, dass mit jedem Monat, mit jedem Jahr die Chancen schwinden, wieder auf die Füße zu kommen. Doch viele haben sich genügsam in ihrer Schattenexistenz eingerichtet.
Und die Familien? „Das Ganze ist sehr schambesetzt“, sagt Evelyn Schulz. „Wie soll man damit umgehen, wenn man einen in der Familie hat, der nicht so ist, wie man es sich vorstellt?“ Ein Stigma auch. Und doch ist Japan „eine Gesellschaft, die der Devianz Räume gibt, und sei es im Privaten. Man lässt die Hikikomori so sein, das ist dann halt so. Natürlich ist da die Scham, natürlich ist da die Hilflosigkeit.“
Das Wort Hikikomori spiegele diese Ambivalenz, sagt die Japanologin. Es beschreibe ein massives gesellschaftliches Problem fast in einer ironischen Brechung mit einem Begriff, der etwas Positives, ja etwas Gemütliches ausstrahle: Ich ziehe mich zurück. Und es schütze vor weiteren Fragen. „Bei dem Begriff weiß jeder, was gemeint ist. Man bohrt nicht weiter nach.“ Denn über psychische Probleme „redet man Japan normalerweise nicht offen. Ich habe es jedenfalls nur selten, meist nur im engeren Freundeskreis erlebt“, sagt Schulz. Der Gang zum Therapeuten ist alles andere als selbstverständlich. Und so braucht es lange, bis die Betroffenen oder ihre Familien Hilfe suchen. Inzwischen aber gibt es eine Menge Anlaufstellen, die den Eltern Beratung und Beistand anbieten und versuchen, Hikikomori mit niederschwelligen Angeboten aus der Isolation zu holen.
Das Problem der Überalterung
Mittlerweile gilt Japan als „Super aged society“. Das Land hat mit derzeit 48,4 Jahren das weltweit höchste Durchschnittsalter der Bevölkerung. Fast 30 Prozent der Einwohner sind 65 und älter. Evelyn Schulz erzählt von ihrem letzten Besuch im Land: „Eine Freundin zeigte mir reihenweise ehemalige Grundschulen, die zu Altenheimen umgebaut worden waren. Wohlgemerkt: Das war im Großraum Tokio, im direkten Einzugsgebiet der Megacity, nicht in abgehängten Regionen.“ Die Überalterung der Gesellschaft, so sagt die Japanologin, ist das beherrschende soziale Thema.
Mit der Gesellschaft als Ganzes sind auch die Hikikomori längst in die Jahre gekommen. Umfragen zeigen, dass ihre Zahl in der Altersgruppe über 40 bald ebenso groß ist wie in der darunter. Teilweise leben sie seit Jahrzehnten zurückgezogen bei ihren inzwischen alten Eltern, finanziell von ihnen noch immer unterstützt. „Oft wird erst dann, wenn beide Eltern gestorben sind, offensichtlich, dass da noch jemand in der Wohnung ist.“ Doch wachsen auch Hikikomori mittleren Alters nach. Umfragen unter 40- bis 65-jährigen Betroffenen zeigten, dass viele von ihnen erst in späteren Jahren ins soziale Aus geraten sind, durch psychische Probleme, sonstige Krankheitsphasen oder Jobverlust.
Welche Rolle spielt bei alldem die zunehmende Digitalisierung? Der Verdacht liegt nahe, dass der Anschluss an die virtuelle Welt das Problem verschärft. In der Tat gelten viele Hikikomori nach gängigen Kriterien als internetsüchtig. Das Netz macht es für die Betroffenen einfacher, soziale Kontakte in der für sie unübersichtlichen und angsteinflößenden realen Welt zu vermeiden. Es schafft ihnen Kommunikation – zu ihren Bedingungen, das Risiko des Versagens ist subjektiv empfunden offenbar geringer.
Aber kann nicht das Internet auch Teil der Lösung sein? Manche Hikikomori, so erzählt Evelyn Schulz, entwickelten online erfolgreich soziale Aktivitäten, in der Selbsthilfe oder als Blogger zum Beispiel. Zumindest aber öffne es „ein Fenster in die abgeschlossene Welt der Hikikomori“ – nicht zuletzt für Therapeuten, Ärztinnen und andere Angehörige des Hilfesystems. Und was in diesem Zusammenhang eher skurril klingt: Sogar ein Spiel wie Pokemon Go hat manche Betroffene angeblich wieder auf die Straße gebracht, weil sie plötzlich in der realen Welt Punkte machen mussten.
Dass überall immer mehr Jugendliche in digitale Welten abtauchen, ist auch eine der Spuren, die das Hikikomori-Syndrom mit ähnlichen Phänomenen in anderen Gesellschaften verbindet. Eine Reihe von Studien findet Häufungen extremer sozialer Selbstisolation unter anderem in Spanien, den USA, Südkorea oder Indien. So warnen manche Forscher heute davor, dass es sich bei Hikikomori um ein Phänomen handelt, das nicht nur Japan trifft, sondern mit modernen Gesellschaften überhaupt verknüpft sein könnte.
Martin Thurau

Prof. Dr. Evelyn Schulz
forscht und lehrt am Japan-Zentrum der LMU. Schulz, Jahrgang 1963, studierte an der Universität Heidelberg und in Kyoto, wurde 1995 promovierte und habilitierte sich 2001 in Japanologie. Zwischen 1995 und 2002 war sie Assistentin und Oberassistentin am Ostasiatischen Seminar der Universität Zürich, bevor sie 2002 an die LMU berufen wurde.










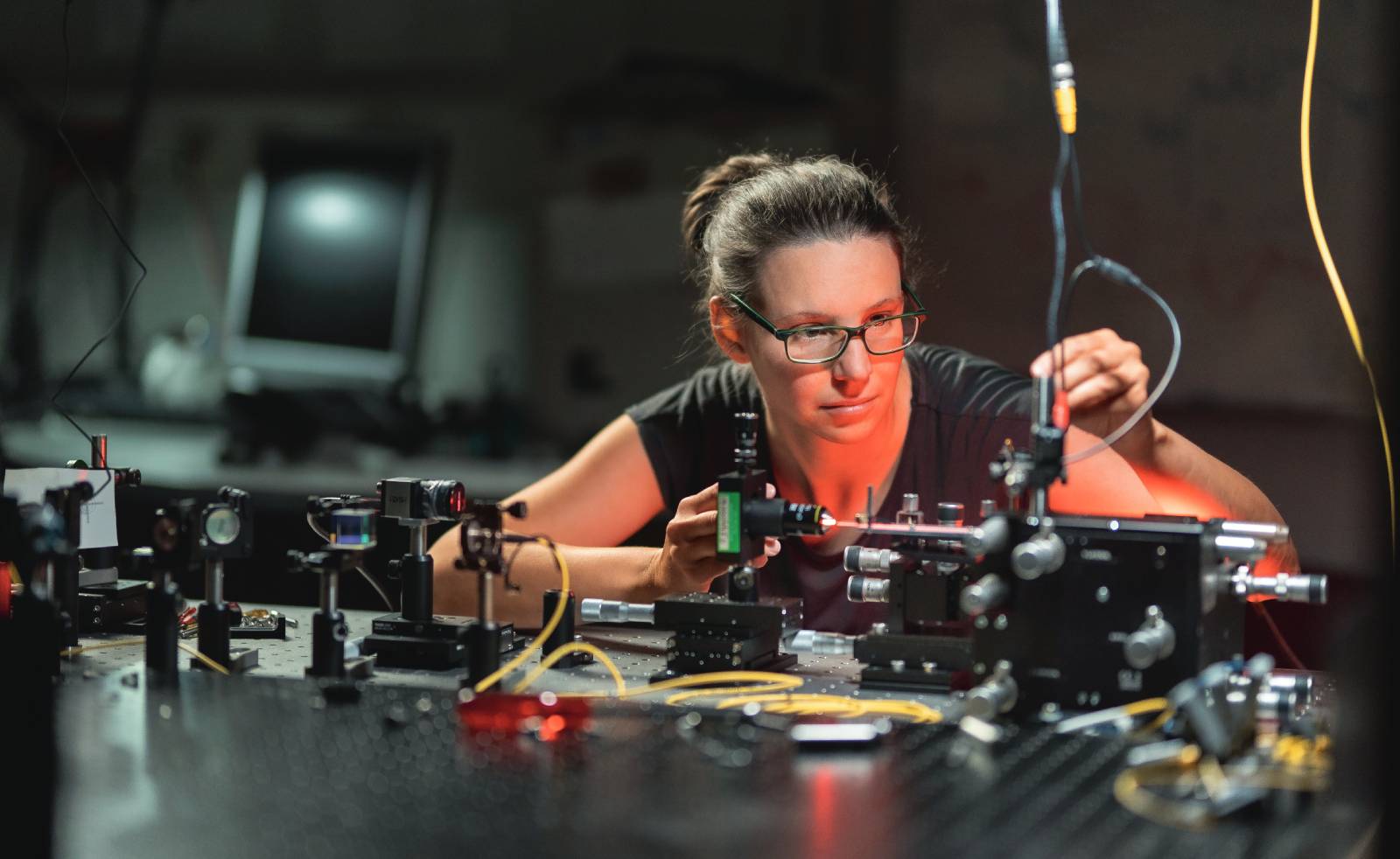










0 Kommentare