Kinder in der Grundschule – und im Alltag mit mehreren Sprachen. Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images
Spielend leicht wechselt der neunjährige Alex zwischen Englisch, Italienisch und Deutsch – je nachdem, mit wem er gerade im Gespräch ist. Geboren in Australien – sein Vater ist Australier, die Mutter kommt aus Kanada –, war Englisch die erste Sprache, mit der der Junge seit seiner Geburt tagtäglich zu tun hatte. Doch nicht nur das: Weil beide Eltern italienische Wurzeln haben, fiel früh die Entscheidung, dass der Vater Italienisch mit ihm sprechen würde. Als Alex gut zwei Jahre alt war, siedelte die Familie nach Deutschland um. In der Kita lernte das Kind Deutsch – quasi ganz nebenbei. Auf seine Eltern dagegen warteten weit größere Schwierigkeiten mit der neuen Sprache. Das lag auch daran, dass die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, in ihrem eigenen Alltag längst nicht so gefragt war wie bei ihrem Sohn.
Mehrsprachigkeit ist kein Thema, das lediglich Kinder wie Alex betrifft, in deren Elternhäusern bereits verschiedene Sprachen an der Tagesordnung sind. Auch wer in ein anderes Land zieht – egal, ob zum Studium, aus beruflichen Gründen oder weil er aus seinem Heimatland fliehen musste –, steht vor der Aufgabe, sich eine weitere Sprache anzueignen. Und zwar möglichst so, dass er sie im Alltag fließend sprechen kann und ihm auch die gesellschaftlich bedingten Feinheiten des Ausdrucks nicht verschlossen bleiben. Denn auch die Integrationspolitik versteht die Sprachkompetenz als Schlüssel zur Integration. Professorin Claudia Maria Riehl, die an der LMU das Institut für Deutsch als Fremdsprache leitet, untersucht, wie es gelingt, eine neue Landessprache möglichst gut zu lernen. Sie weiß: Eine wichtige Rolle spielt dabei der Kontext, ob also das Gelernte in Alltagssituationen wie in der Schule oder am Arbeitsplatz erprobt oder vorwiegend in der eher künstlichen Situation des Sprachunterrichts zum Einsatz kommt. Und: Wie gut die Lerner ihre Herkunftssprache beherrschen – und zwar in Wort und Schrift – hat ebenfalls entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg.
„Sprachen haben mich schon immer fasziniert“, sagt Claudia Maria Riehl. Da sei schon in der Schule so gewesen. Als erste Fremdsprache habe sie Latein gelernt: „Eigentlich schon fast eine Verschwendung“, kommentiert sie mit einem feinsinnigen Lächeln. Schließlich ist Latein keine Sprache, die dabei hilft, mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen in Kontakt zu kommen. „Andererseits haben mir meine Lateinkenntnisse natürlich den Zugang zum Italienischen und weiteren romanischen Sprachen geöffnet.“
Sich mit immer neuen Sprachen zu befassen, ist eine Leidenschaft, die Riehl bis heute begleitet. Vor allem aber will sie wissen, was Menschen dabei hilft, wenn sie Sprachen lernen – oder eben wie Alex tagtäglich sogar mit mehreren jonglieren. Da lag es nahe, Germanistik zu studieren und schließlich als Linguistin an genau solchen Fragen zu forschen. „Ich habe mich zunächst für deutschsprachige Minderheiten im Ausland interessiert, also beispielsweise in Ostbelgien, Südtirol, Osteuropa, aber auch in Namibia“, berichtet Riehl. Später, als Professorin in Köln, begann sie ihre Arbeit auf die Situation in Deutschland zu fokussieren, insbesondere auf die Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit Migration. Ein Thema, dem sie sich auch in München noch widmet.

Die Muttersprache gut zu beherrschen, hilft beim Deutschlernen
Zwar gibt es keine eindeutig belegbaren Zahlen zur Mehrsprachigkeit in Deutschland. Bekannt ist aber, dass in einigen Großstädten der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei rund fünfzig Prozent liegt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in einigen Regionen etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler neben dem Deutschen zu Hause noch eine andere Sprache nutzt. Eine häufige Frage ist: Wie lernt ein Kind Deutsch, wenn es zu Hause bis zum Kindergartenalter ausschließlich die Herkunftssprache seiner Eltern spricht? Wie, wenn es erst als Schulkind oder Teenager nach Deutschland kommt? Und welche Rolle spielt dabei die Erstsprache?
„Häufig begegnen wir hier dem Vorurteil, dass die Erstsprache beim Erlernen des Deutschen hinderlich sein könnte“, sagt Riehl. Daher wird immer wieder in Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, dass Kinder neben dem Deutschunterricht auch ergänzenden Unterricht in der Herkunftssprache erhalten oder ob dies sogar eher nachteilig ist. „Wir können aufgrund unserer Untersuchungen mit Sicherheit sagen, dass der ergänzende Unterricht kein Schaden ist“, sagt die Sprachwissenschaftlerin. „Vielmehr kann es sogar eine große Hilfe sein, wenn die Kinder ihre Erstsprache gut beherrschen.“ Das mag jedem einleuchten, wenn es sich etwa um verwandte Sprachen handelt. Wenn die Kinder – oder auch erwachsene Lerner – beim Deutschlernen etwa Vokabeln aus ihrer Muttersprache ableiten können, oder wenn sie sich an ähnlichen grammatikalischen Konstruktionen orientieren.
Aber auch bei Sprachen wie Arabisch, die mit dem Deutschen nicht verwandt sind, ist es förderlich, wenn Lerner ihre Erstsprache gut beherrschen. Denn jede Sprache schult Textkompetenzen und kommunikative Fähigkeiten. „Wenn ein Kind bereits in einer Sprache gelernt hat, einen zusammenhängenden Text zu schreiben, dann wird es sich leichter tun, diese Aufgabe auch im Deutschen zu bewältigen“, erklärt Riehl. Es hat dann zum Beispiel gelernt, eine Geschichte zu erzählen, weiß, wie es Spannung erzeugt, wie es mit Adjektiven eine Szene beschreibt oder wie die wörtliche Rede funktioniert – und kann all dies auch im Text wiedergeben.
Besondere Schwierigkeiten beobachtet allerdings die Sprachwissenschaftlerin bei Kindern, die aufgrund von Krieg und Flucht, über mehrere Jahre keinen Schulunterricht besuchen konnten. „Da fehlen genau diese Textkompetenzen und die Schüler tun sich schwer, diese Fähigkeiten dann in der neuen Sprache, also im Deutschen, zu erlernen“, so Riehl. Auch hier könnte es möglicherweise förderlich sein, die fehlende Textkompetenz zunächst einmal in der Muttersprache zu lernen, die das Kind zumindest mündlich bereits beherrscht. Untersucht hat die Forscherin diesen Aspekt allerdings noch nicht. Sicher ist sie sich indes in einem Punkt: „Kinder, die ihre Muttersprache gut beherrschen, sind auch in der deutschen Sprache besser.“ Jede Förderung einer Sprachkompetenz käme letztlich der Gesamtsprachkompetenz zugute. Und nicht nur das: Mehrsprachigkeit, das haben Wissenschaftler längst bewiesen, fördert die geistige Flexibilität. Denn zwischen zwei oder mehr Sprachen zu wechseln, bedarf ausgeprägter kognitiver Kontrollfunktionen – was sich nicht nur in verbalen Kompetenzen niederschlägt. Die sogenannten exekutiven Funktionen des Gehirns werden gestärkt, also Mechanismen, die allgemein für Aufmerksamkeitskontrolle zuständig sind.
Ankommen nach der Flucht aus Syrien
Dass die Integrationspolitik den Spracherwerb zum Heiligen Gral der Eingliederung erkoren hat, ist also vom Grundsatz her gerechtfertigt. Doch Spracherwerb ist nicht gleich Spracherwerb. Wie gut Kinder und erwachsene Schüler eine neue Landessprache erlernen und dann auch im Alltag anwenden können, hängt von vielen Faktoren ab.
Das hat Riehl erst unlängst gemeinsam mit ihrer Kollegin an der LMU, Katrin Lindner, und kanadischen Kolleginnen der Universität Toronto untersucht. Die Wissenschaftlerinnen wollten wissen, ob es Unterschiede gibt, wie Migranten, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind, die jeweilige Landessprache in Deutschland beziehungsweise Kanada erlernen. Sie befragten dazu 15 syrische Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren – neun lebten in Toronto und sechs in München – sowie ihre Eltern zu ihren Sprachgewohnheiten: Nutzen sie im Alltag eher ihre Herkunftssprache oder die neue Landessprache?
Tatsächlich zeigten sich hier immense Unterschiede zwischen den Befragten in Kanada und in Deutschland. In Kanada gaben die syrischen Familien an, zu Hause vorwiegend Arabisch beziehungsweise Kurdisch zu sprechen. Sie hielten auch ihre Kinder dazu an, untereinander die jeweilige Muttersprache zu verwenden. Die Eltern betonten, dass es wichtig sei, die Muttersprache nicht zu verlernen und lebendig zu halten. Der Wunsch, dass die Kinder gut Arabisch sprechen sollten, war in muslimischen Familien noch verstärkt, da dies die Sprache des Korans ist. Religiöse Motive spielen beim Sprachgebrauch also auch eine Rolle. Aber auch den christlichen Familien sowie den Kurdisch-Sprechern, war es wichtig, zu Hause die Herkunftssprache zu praktizieren.
Englisch, so die Überzeugung der Befragten, würden die Kinder ohnehin in der Schule und im Spiel mit Gleichaltrigen lernen. Die Eltern waren ebenfalls stark engagiert, Englisch zu lernen und ihre Sprachkompetenzen zu verbessern – sowohl im Sprachunterricht als auch bei der Arbeit. Insgesamt, so interpretierten die Wissenschaftlerinnen, waren alle Familien bemüht, sich gut in die Gesellschaft ihrer neuen Wahlheimat zu integrieren.
Mehrsprachigkeit als Grundvoraussetzung für eine moderne Gesellschaft
Die syrischen Familien in Deutschland zeigten dagegen andere Präferenzen beim Sprachgebrauch. Zwar nutzten sie untereinander ebenfalls ihre Herkunftssprache. Doch die Kinder sprachen untereinander lieber Deutsch – was den Eltern nur recht zu sein schien: Sie bestanden darauf, wie wichtig es für die Kinder sei, die neue Landessprache zu beherrschen. Die Erwachsenen selbst, hatten größere Schwierigkeiten mit dem Deutschen als ihre Kinder. Sie taten sich mit dem Spracherwerb aber auch deutlich schwerer als die Befragten in Kanada und zeigten insgesamt keine ausgeprägten Tendenzen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren – ihre Kinder fügten sich dagegen sehr gut ein. „Das ist eine unglaubliche Leistung, die die Kinder hier zeigen: Sie fungieren damit auch als Sprach- und Kulturbotschafter ihrer Eltern und für ihre Eltern,“ so Riehl.
Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen syrischen Flüchtlingen in Kanada und Deutschland? „Eine Erklärung sind gravierende Unterschiede im Hinblick auf die Alltagsbedingungen“, sagt Riehl. Die syrischen Neuankömmlinge in Deutschland leben lange Zeit in Flüchtlingsheimen und haben keine Möglichkeit zu arbeiten. So sind sie oft vorwiegend in Kontakt mit Menschen aus ihrem eigenen Herkunftsland. Deutsch lernen sie zwar im Sprachkurs, aber sie haben kaum Gelegenheit, die Sprache im Kontakt mit Muttersprachlern zu nutzen. „Gerade da würden sie die Feinheiten der Sprache lernen“, sagt Riehl. „Dazu gehört auch, wann welche Formulierungen oder Äußerungen angemessen sind und wann nicht.“
In Kanada dagegen bekommen die Flüchtlingsfamilien schnell eigene Wohnungen und eine Arbeitserlaubnis. Das unterstützt Erwachsene wie Kinder, die neue Sprache auch im Alltag zu nutzen und dabei die kulturellen Feinheiten zu lernen. So bleibt Sprache nicht nur Theorie, sondern wird auch zum Werkzeug, sich eine neue Gesellschaft mit ihren Regeln und Gebräuchen zu erschließen und sich schließlich zu integrieren. „Wir müssen dieses Schubladendenken überwinden, diese Ideologie, die Sprachen als abgeschlossene Systeme betrachtet“, fasst Riehl zusammen und betont: „Mehrsprachigkeit ist kein Handicap von Einwanderern mit Integrationsproblemen; sie ist eine der Grundvoraussetzungen für eine moderne Gesellschaft.“
Stefanie Reinberger

Prof. Dr. Claudia Maria Riehl
ist Inhaberin des Lehrstuhls für Germanistische Linguistik mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache und Leiterin des Instituts für Deutsch als Fremdsprache an der LMU. Riehl, Jahrgang 1962, studierte Deutsche Philologie, Latein und Italienisch an der Katholischen Universität Eichstätt, wo sie in Germanistischer Linguistik auch promoviert wurde. Nach ihrer Habilitation an der Universität Freiburg und wissenschaftlichen Stationen an den Universitäten Freiburg, Kiel und Prag wurde sie zunächst zur Professorin für Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Köln berufen, bevor sie 2012 an die LMU kam.










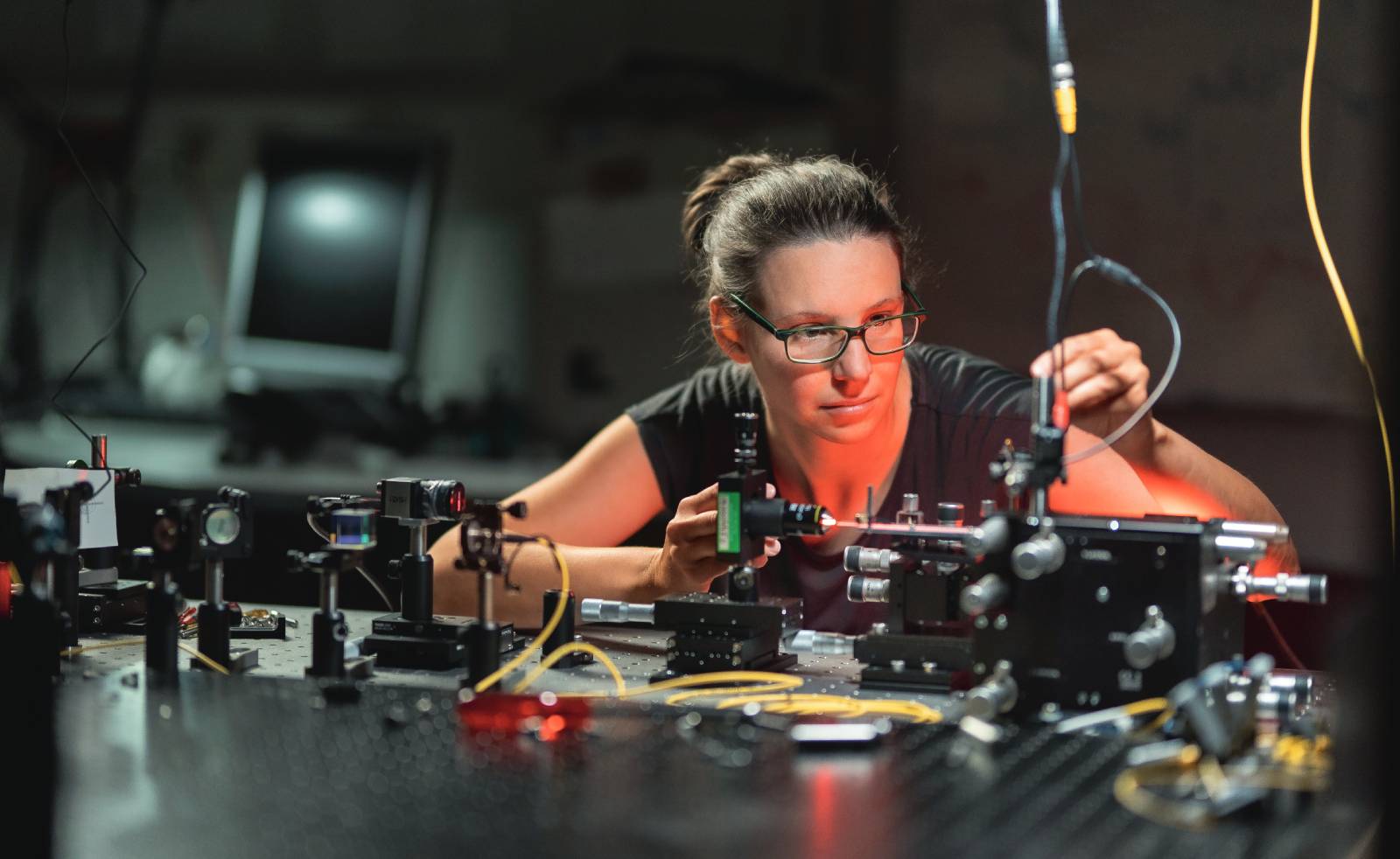










0 Kommentare