Nüchterne Sprache, ernüchterndes Ergebnis: „Zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger finden, dass es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland eher schlecht bestellt ist.“ Mit diesem Befund ging das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im November 2022 an die Öffentlichkeit. Der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer sieht in einem solchen Umfrage-Ergebnis durchaus ein Warnsignal. Er rät allerdings auch zur Vorsicht, die Aussage nicht überzuinterpretieren. Bei der Formulierung von Befragungen ist aus seiner Sicht viel Bedacht nötig. Allein die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt könne bei den Befragten einen mentalen Prozess in Gang setzen: „Gehöre ich zu denen, die eine Spaltung sehen? Oder zu den anderen?“ Und schon ordnet sich jemand einer Gruppe zu und grenzt sich von einer anderen ein wenig ab.
Sich selbst in der Gesellschaft an einer bestimmten Stelle zu verorten und sich mit anderen zu identifizieren, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, zu allen Zeiten und überall auf der Welt, stellt Gollwitzer fest: „Irgendwo dazuzugehören, Teil einer Gruppe zu sein, und dort auch die Rückmeldung zu bekommen: Du bist ein akzeptiertes Mitglied.“ Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis erforschen Sozialpsychologen wie Gollwitzer unter anderem, was Menschen miteinander verbindet und voneinander trennt, was Gesellschaften stabilisiert und was sie erschüttert.
Streben nach Kontrolle
Neben dem Bedürfnis, sich einer Gruppe zuordnen zu können, hat die Sozialpsychologie weitere Grundbedürfnisse der Menschen in modernen Gesellschaften herausgearbeitet: Etwa das Gefühl, frei und autonom entscheiden zu können. Schwer verzichtbar sind für viele Menschen auch Vorhersehbarkeit und Stabilität. Gerade das Bedürfnis, absehen zu können, was auf sie zukommt, werde in letzter Zeit allerdings nicht gerade gestillt, glaubt Gollwitzer: „Umbrüche wie die Corona-, die Klimakrise oder der Krieg sind immer eine Bedrohung für unser Streben nach Stabilität, Ordnung, Vorhersehbarkeit und Kontrolle.“ Gleichzeitig beobachtet der LMU-Forscher ein stärkeres Lagerdenken als in früheren Jahrzehnten.
Natürlich hat es immer schon bei vielen Fragen eine gesellschaftliche Aufspaltung gegeben. Etwa in den 1980er-Jahren: „Bist du für oder gegen die Nato-Nachrüstung? Bist du für oder gegen Atomkraft?“ Aber „inzwischen“, so sagt Gollwitzer, „sortiert sich die gesamte Gesellschaft immer stärker in Gruppen, die sich über Abgrenzung von anderen definieren: die Rechten, die Linken. Die Querdenker, die Normaldenker. Die Generation Z und die Boomer. Die letzte Generation und die SUV-Fahrer.“ Die Kommunikation über soziale Netzwerke tut ihren Teil dazu: „Über eine limitierte Zeichenzahl lässt sich Komplexität nur begrenzt ausdrücken“, sagt Gollwitzer.
Opferrolle als Selbstbild
Gleichzeitig beobachtet er eine stärkere Tendenz, sich als Opfer anderer gesellschaftlicher Gruppen zu sehen. Diese Beobachtung will er mit seinem Kollegen Karsten Fischer vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der LMU tiefer ergründen. In einem Forschungsprojekt gehen sie einem Phänomen nach, das die US-Soziologen Bradley Campbell und Jason Manning in den Buchtitel The rise of Victimhood Culture gefasst haben. Gollwitzer findet den englischen Begriff „Victimhood Culture“ allerdings etwas problematisch. Denn die Idee einer „Opfer-Kultur“ oder gar eines „Opfer-Kults“ verkürzt aus seiner Sicht doch arg die Vielschichtigkeit des Phänomens, das dahintersteht. Was ihn besonders interessiert, ist die Frage, wie ein solcher Kulturwandel – wenn es ihn denn gibt – in den Köpfen der einzelnen Menschen genau repräsentiert ist. Die Arbeitshypothese: Wenn es eine solche „Opfer-Kultur“ wirklich gibt, müsste auch die individuelle Sensibilität für Ungerechtigkeit in den letzten 20 Jahren angestiegen sein. Ob es hierfür empirische Hinweise gibt, wollen Gollwitzer und sein Team nun herausfinden.

Wie prägen aber nun Opfer-Narrative die politische Landschaft Deutschlands, und wie verändern sich diese Haltungen? Dafür gehen die Forscher Wahl- und Parteiprogramme der letzten fünf Bundestagswahlen durch und untersuchen die entsprechenden Texte aller Parteien. Gollwitzer vermutet, dass Opfer-Narrative stärker an den politischen Rändern zu finden sind als in der Mitte. Und erste Befunde zeigen auch in diese Richtung.
Gefangen im Ungerechtigkeits-Daueralarm
Die Botschaft „Meine Gruppe wird von anderen Gruppen benachteiligt, bevormundet, ihrer Freiheit beraubt“ kann allerdings nur verfangen, wenn Menschen für solche Ideen empfänglich sind. Und hier untersucht Gollwitzer schon seit Längerem das, was in der Sozialpsychologie als „Ungerechtigkeits-Sensibilität aus der Opferperspektive“ – oder kurz: „Opfersensibilität“ – diskutiert wird: „Das sind Leute, die mit einer Art Alarmsystem durchs Leben gehen und der Meinung sind, dass überall die Gefahr lauert, ausgenutzt zu werden, hintergangen zu werden, schlecht behandelt zu werden.“ Menschen mit diesem Alarmsystem seien wiederum besonders anfällig für Opfer-Narrative.
Um eine besonders ausgeprägte „Opfersensibilität“ zu erkennen, sind laut Gollwitzer Befragungen gut geeignet. Dabei sei es wichtig, die Fragen so wenig suggestiv wie möglich zu formulieren. Fragen können dann beispielsweise lauten, ob Menschen Sätzen wie diesen zustimmen: „Es geht mir lange nach, wenn ich schlechter behandelt werde als andere.“ Oder auch: „Es macht mir zu schaffen, wenn ich sehe, dass andere Menschen bevorzugt werden und ich benachteiligt werde.“
Die Illusion der objektiven Gerechtigkeit
Die Frage „Werde ich gerecht behandelt?“ geht allerdings mit einer weiteren Frage einher: „Was ist gerecht?“ Und auf diese Frage gibt es keine klare Antwort. Wenn beispielsweise eine Ressource unter mehreren Menschen zu verteilen ist, gibt es mehrere Prinzipien, die alle ihre Berechtigung haben. So könnte man zum Beispiel das Gleichheitsprinzip anwenden: Alle bekommen gleich viel. Ein Beispiel wäre die Energiekostenpauschale für Studierende, die für alle gleich hoch ausgefallen ist, egal ob sie aus einem Millionärs-Elternhaus oder aus einem Elternhaus von Grundsicherungsbeziehern kommen.
„Umbrüche wie die Corona-, die Klimakrise oder der Krieg sind immer eine Bedrohung für unser Streben nach Stabilität, Ordnung, Vorhersehbarkeit und Kontrolle.“
Aber auch das Bedürftigkeitsprinzip kann als gerecht gelten: So erhalten Bezieher von BAföG oder Wohngeld einen erhöhten Heizkostenzuschuss. Voraussetzung ist bei diesem Prinzip allerdings stets, dass die Bedürftigkeit geprüft werden muss, was nicht ohne bürokratischen Aufwand zu leisten ist. Als eine dritte Form der Verwirklichung von Gerechtigkeit gilt das Beitragsprinzip. So gilt in Deutschland in der Rentenversicherung als gerecht: Wer mehr eingezahlt hat, erhält später eine entsprechend höhere Leistung, unabhängig davon, ob er etwa nach einem Berufsleben mit hohem Einkommen hohe Altersbezüge wirklich braucht.
Politik in komplexen Gesellschaften sieht Gollwitzer dabei in einer Dilemma-Situation: „Denn diese drei genannten Gerechtigkeitsprinzipien schließen einander logisch aus.“ Das Gleichheitsprinzip widerspricht dem Bedürftigkeitsprinzip. Und beide widersprechen wiederum jeweils dem Beitragsprinzip. Deswegen bedeutet Politik, immer wieder neu zu entscheiden, welches Gerechtigkeitsprinzip auf welchem Feld in welcher Form angewandt werden soll, und dabei immer wieder Kompromisse zu schließen.
Der Irrtum, der Kuchen bleibe immer gleich groß
Politik muss sich dabei, sagt Gollwitzer, mit einigen sozialpsychologischen Grundkonstanten auseinandersetzen. So ist ein Phänomen inzwischen gründlich erforscht, das im englischen Sprachraum den Namen „Fixed-Pie-Bias“ bekommen hat: Menschen neigen zu der Fehl-Annahme, der Kuchen, der verteilt werden kann, bleibe immer gleich groß. Was dazu führen würde, dass dann, wenn neue Gruppen einen Teil vom Kuchen wollen, andere bereits etablierte Gruppen jeweils kleinere Stücke bekommen.

Zusätzliche Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen zu befriedigen, wäre dann also ausschließlich möglich, wenn andere Bevölkerungsgruppen zurückstecken. Beispielsweise Zuwanderern ein gutes Leben zu ermöglichen, ist nach dieser Wahrnehmung nur denkbar, wenn diejenigen, die schon im Land sind, kürzer kommen. Oder einer wachsenden Zahl von Rentnern ein gutes Leben zu gewährleisten, wäre nach der Idee des „Fixed-Pie-Bias“ nur möglich, wenn die Berufstägigen zurückstecken.
Doch dass in einer Volkswirtschaft mit stetig wachsender Produktivität und Wirtschaftsleistung der Kuchen immer größer wird, werde oft übersehen, stellt Gollwitzer fest. Entsprechend können zusätzliche Kuchenstücke gegebenenfalls auch verteilt werden, ohne dass jemand weniger bekommt. „Das ist allerdings kognitiv etwas schwerer zu verarbeiten als die Idee einer festen Obergrenze“, resümiert der Sozialpsychologe.
Dass die Angst, in einem Verteilungskonflikt zu kurz zu kommen, bestehende gesellschaftliche Gräben vertieft oder überhaupt erst aufreißt, daran kann seiner Ansicht nach kaum Zweifel bestehen. Aber sinnvoll wäre es aus Sicht der Sozialpsychologie, immer wieder deutlich zu machen, dass eben jedes Verteilungsprinzip seine Berechtigung hat und Kompromisse oft eine gute Lösung für einen Konflikt darstellen.
Zusammenhalt durch Feindschaft?
Zusammenhalt lässt sich aber auch noch auf andere Weise stärken, stellt Gollwitzer mit einem leichten Seufzen fest: „Eine Gruppe kann man dann zusammenhalten, wenn man einen äußeren Feind produziert.“ Das lässt sich beispielsweise in Russland beobachten, „wo die Erzählung, das Land müsse sich mit Gewalt gegen äußere Feinde zur Wehr setzen, in der Bevölkerung bislang stärker verfängt, als viele Menschen in westlichen Ländern erwartet oder erhofft hatten“. Gleichzeitig habe der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, zumindest auf einer staatspolitischen Ebene, die Mitgliedsländer der Europäischen Union wieder stärker zusammengebracht, glaubt Gollwitzer: „Das gilt als Angriff auf die westlichen Werte, also auf uns. Und das lässt die EU-Staaten oder die NATO wieder zusammenrücken.“
Zusammenhalt zu leben ohne äußere Feinde oder ohne feindselige Abgrenzung von anderen Gruppen innerhalb der eigenen Gesellschaft, das wäre für ein zivilisiertes Land natürlich das Erstrebenswerteste, findet Gollwitzer. Dazu aber müssten die Menschen Unsicherheit ebenso aushalten wie Verschiedenheit: „Und das ist anstrengend. Doch eine gute Alternative dazu sehe ich nicht.“
Nikolaus Nützel
Prof. Dr. Mario Gollwitzer ist Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie am Department Psychologie der LMU. Gollwitzer, Jahrgang 1973, studierte Psychologie an der Universität Trier, wo er auch promoviert wurde, bevor er an die Universität Koblenz-Landau wechselte. Dort leitete er das Zentrum für Methoden, Diagnostik und Evaluation. Nach acht Jahren an der Philipps-Universität Marburg kam er 2018 an die LMU.


















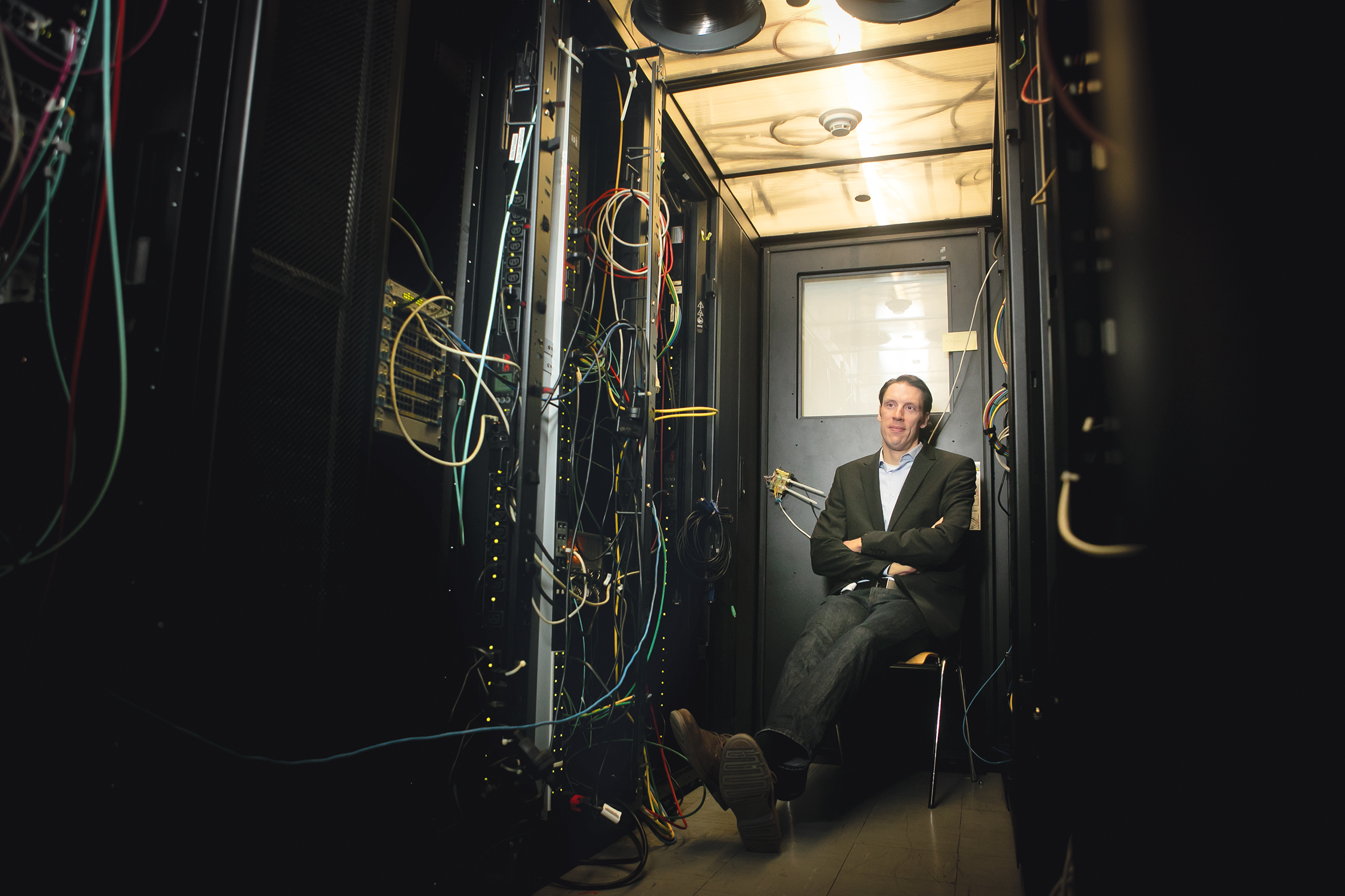





0 Kommentare