Es war eine offene Kampfansage: Der US-Amerikaner Craig Venter verkündete im Mai 1998, er werde mit seiner Firma Celera Genomics das menschliche Genom entschlüsseln – im Alleingang und schneller als das mit öffentlichen Geldern finanzierte internationale Humangenomprojekt, das bereits seit 1990 daran arbeitete.
Daraufhin begann ein erbitterter Wettlauf zwischen Venter und dem Konsortium, der die Schlagzeilen beherrschte und noch heute den Blick auf das Humangenomprojekt prägt: „Es gilt oft als paradigmatisches Beispiel für schädlichen Wettbewerb, weil man immer nur das Ausscheren von Venter sieht“, sagt Kärin Nickelsen. „Aber eigentlich ist das Humangenomprojekt über weite Strecken ein Beispiel für produktive Kooperation und ein gelungenes Einhegen von Konkurrenz.“ Die Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der LMU ist Sprecherin der DFG-Forschungsgruppe „Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften“ und hat mit diesem Team am Beispiel des Humangenomprojekts untersucht, wie Forscherinnen und Forscher sich im Spannungsfeld von Konkurrenz und Kooperation positionieren.
Sie befinden sich dabei in einer paradoxen Situation: Konkurrenz gilt zwar als eine Triebfeder der Wissenschaft. Im Idealfall konkurrieren Wissenschaftler um Erkenntnis und werden angespornt von dem Wunsch, bei einer Entdeckung die ersten gewesen zu sein. Gleichzeitig sind sie aber auf Kooperation angewiesen, denn ohne Vernetzung und Austausch ist erfolgreiche Forschung kaum mehr möglich. Der einsame Forscher im Elfenbeinturm war schon immer eher ein Klischee, und komplexe Fragestellungen erfordern mehr denn je die Beteiligung vieler mit unterschiedlichen Kompetenzen und Methoden. Konkurrenz und Kooperation gehen also Hand in Hand – und die Kooperationspartner von heute können die Konkurrenten von morgen sein.
Wie dieses Wechselspiel der Interessen austariert wird, fasziniert Nickelsen seit dem Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere. „In meiner Habilitation habe ich mich mit der Gemeinschaft der Wissenschaftler beschäftigt, die zwischen 1840 und 1960 die Photosynthese erforschten“, erzählt sie. „Dabei wurde mir klar, dass der Wissensaustausch Mustern unterliegt, die ungeschriebenen Normen folgen.“
Nicht nur einer kann gewinnen
Nickelsens Beobachtungen zufolge werden Konkurrenzsituationen häufig von vornherein vermieden, durch Absprache oder strategische Themenwahl. Dabei hilft den Forschenden, dass in der Wissenschaft in den seltensten Fällen nur eine Person gewinnen kann und alle anderen verlieren. „Variationen etwa der Methoden und Modellorganismen – in der Photosyntheseforschung etwa Blaualgen versus Grünalgen – verhindern, dass man sich in die Quere kommt, auch wenn man grundsätzlich dasselbe Ziel verfolgt.“ Auch bei echten Kooperationen sind Absprachen über Ziele und Methoden zwischen den Partnern wichtig.
„Das Humangenomprojekt gilt oft als paradigmatisches Beispiel für schädlichen Wettbewerb. Aber eigentlich ist es vielmehr ein Beispiel für gute Kooperation und gelungenes Einhegen von Konkurrenz.“
Eine besondere Dynamik gewinnt das Wechselspiel von Konkurrenz und Kooperation, wenn es auch um monetären Profit geht: Die noch junge Genomforschung entwickelte sich ab Mitte der 1980er Jahre zu einem wissenschaftlich und ökonomisch attraktiven Forschungsfeld. Allerdings war die Sequenzierung von DNA äußerst zeitintensiv und teuer. Um möglichen Spannungen und Reibereien zu begegnen, einigten sich die Mitglieder des Humangenomprojekts im Vorfeld auf Ziele und eine Agenda, die von einer Strategiegruppe „hart ausgehandelt wurden“, so Nickelsen. Innerhalb dieses Rahmens arbeiteten die Gruppen unterschiedlich eng zusammen: Manche kooperierten, andere kollaborierten sogar und verfolgten Hand in Hand dasselbe Ziel. Häufig blieb es aber bei koordinierten Absprachen, etwa dazu, wer welche Chromosomen entschlüsselt – keine triviale Frage, weil manche Chromosomen interessanter waren als andere. Im Lauf der Zeit wurde zudem klar, dass der Umgang mit Daten ein Problem war. Ob Daten öffentlich gemacht oder privatisiert werden sollten, war auch innerhalb des Konsortiums zunächst umstritten. Aus dieser Diskussion entstand eine Vereinbarung, die bis heute Vorbildcharakter hat: Danach mussten alle Forschungsgruppen ihre Daten innerhalb von 24 Stunden in einer gemeinsamen Datenbank online allen zur Verfügung stellen.
Nur das Tempo zählte: Venters Alleingang in den Wettbewerb
Für Nickelsen ist diese Festlegung auf Gemeinfreiheit der Daten eine der erstaunlichsten Entwicklungen des Humangenomprojektes. „Die großen Institute wurden durch diese Regeln eingeschränkt und mussten ihren Vorsprung aufgeben. Aber nur so ließ sich verhindern, dass die Datenauswertung monopolisiert wurde: Das hätte die Kooperation gesprengt, auf die letztlich alle angewiesen waren.“ Den Beobachtungen der Forschungsgruppe zufolge ist diese Strategie weit verbreitet: Gefährdete Kooperationen lassen sich durch Infrastruktur und Regeln stabilisieren – etwa durch eine gemeinsame Datenbank oder festgelegte Routinen im Handlungsablauf.
Craig Venter dagegen verpflichtete sich nicht auf gemeinfreie Daten; umgekehrt nutzte er aber die Daten des Konsortiums, wie sich später zeigte. Mit seinem Alleingang eröffnete er zudem nicht nur einen Wettbewerb, sondern änderte auch die Erfolgskriterien: Plötzlich ging es mehr um Tempo und öffentliche Aufmerksamkeit als um die Qualität der Daten. „Venter nahm bewusst in Kauf, dass das Konsortium um seine Finanzierung fürchten musste, wenn es an den eigenen Maßstäben festhielt. Damit stieß er viele in der Community vor den Kopf.
Der eine in Science, die anderen in Nature
Beendet wurde der Streit durch das Eingreifen von US-Präsident Bill Clinton und dem britischen Premierminister Tony Blair. Diese verkündeten im Juni 2000, das Genom sei nun entschlüsselt, und zwar von beiden Parteien gleichzeitig. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt noch keiner der Kontrahenten am Ziel. Ihren allerersten, noch sehr unvollständigen Entwurf publizierten beide Gruppen 2001 je einzeln in den wichtigen Fachblättern Science (Venter) und Nature (Konsortium). Wirklich abgeschlossen ist die Sequenzierung des menschlichen Genoms erst seit April 2022.
Dass Staatsführer direkt in den Streit konkurrierender Wissenschaftler eingreifen, dürfte eher ungewöhnlich sein. Grundsätzlich zielt Wissenschaftspolitik aber oft darauf ab, ein bestimmtes Verhältnis von Konkurrenz und Kooperation herzustellen. Seit den 1980er Jahren hat sich das Wettbewerbsparadigma auch hier als Leitprinzip durchgesetzt, meint Nickelsen. Allerdings funktionieren in ihren Augen weder Kooperationszwang noch verschärfter Konkurrenzdruck besonders gut, weil beides von den Akteuren häufig umgangen wird, sei es durch Absprachen oder Nichtbeteiligung.Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland etwa, wie andere Mitglieder der Forschungsgruppe zeigten, verzögerte bewusst die Beteiligung Deutschlands an neuen Formaten der Europäischen Union, die sich bemühte, innereuropäische Forschungskooperation anzuregen, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern. „Man wollte verhindern, dass Deutschland substanziell Fördermittel auf EU-Ebene verlagerte und somit dem exklusiven Zugriff deutscher Institutionen entzog.“ Diese Haltung änderte sich erst, als die EU-Mittel stark anstiegen.
Belebt Konkurrenz das Forschungsgeschäft?
Dazu kommt: Konkurrenz kann zwar auch in der Wissenschaft das Geschäft beleben, aber „nicht immer so, wie wir es gerne hätten.“ Wenn etwa eine leistungsorientierte Mittelvergabe aus einer festen Gesamtsumme erfolge, quasi als Nullsummenspiel zwischen den beteiligten Institutionen, könne das dazu führen, dass Arbeitsgruppen oder Standorte gegeneinander arbeiten statt miteinander, erklärt Nickelsen. Abfedern lasse sich das, wenn auch kooperative Initiativen bei der Entscheidung über die Förderung berücksichtigt werden. Nickelsens persönliches Fazit: Kooperation lohnt sich oft mehr als Konkurrenz. „Forschende suchen sich ihre Wege zwischen Kooperationszwang und Konkurrenzdruck. Sie versuchen, strategisch zu kooperieren oder sich zu koordinieren, und zwar viel häufiger und kreativer, als wir erwartet hätten. Das tun sie nicht, weil sie besonders gute Menschen sind, sondern weil es ressourcenschonend ist und man auf diese Weise mehr erreicht.“
Monika Gödde
Prof. Dr. Kärin Nickelsen ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftsgeschichte an der LMU. Nickelsen, Jahrgang 1972, studierte Biologie und Wissenschaftsgeschichte in Göttingen und Glasgow. Promotion und Habilitation an der Universität Bern. Von 2006 an war sie dort Assistenzprofessorin für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte, bevor sie im Jahr 2011 an die LMU berufen wurde. Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und an der University of Illinois. Kärin Nickelsen ist Sprecherin der DFG-finanzierten Forschungsgruppe „Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften“. Maßgeblich beteiligt sind daran auch die Historikerinnen Prof. Dr. Elke Seefried (RWTH Aachen) und Darina Volf (LMU) sowie die Historiker Dr. Christoffer Leber (LMU), Prof. Dr. Kiran Klaus Patel (LMU), Prof. Dr. Martin Schulze Wessel (LMU), Prof. Dr. Helmuth Trischler (Deutsches Museum) und Prof. Dr. Andreas Wirsching (LMU und Institut für Zeitgeschichte).


















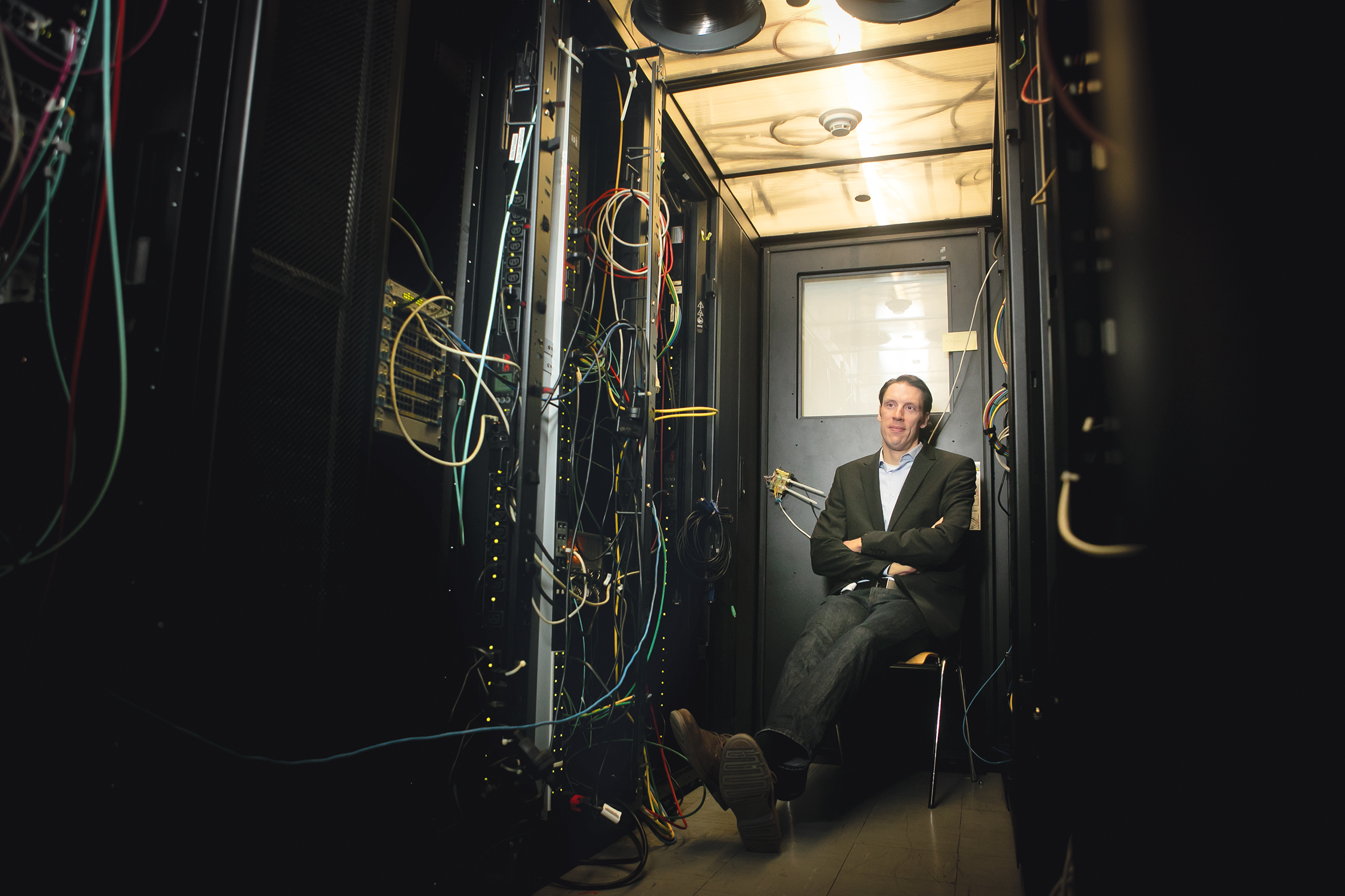





0 Kommentare