Es gab eine Zeit, in der sich vor allem junge Männer für Computerspiele begeisterten. Diese saßen dann mit ihrem Controller stundenlang in abgedunkelten Räumen am Bildschirm. So das Klischee. „Inzwischen spielt jeder, Frauen genauso wie Männer, junge Menschen wie ältere, im Schnitt ist der Durchschnittsuser derzeit 35 Jahre“, sagt Johanna Pirker. Es ist einer der Gründe, warum die Medieninformatikerin in Computerspielen sehr viel mehr sieht als einen entspannenden Zeitvertreib. Sie will Spiele nutzen, um Menschen zu motivieren, sich mit Themen zu beschäftigen, die sonst kaum auf deren Interesse gestoßen wären.
Pirker, derzeit Professorin für Medieninformatik an der LMU, erforscht, wie sich Videospiele und ganz allgemein virtuelle Realität nutzen lassen, um die Welt verständlicher und damit besser zu machen. Sie will verstehen, was und wie wir Menschen in künstlichen Umgebungen für die reale Welt lernen können, und entwickelt dafür geeignete virtuelle Welten. Sie will wissen, wie wir darin interagieren, uns orientieren und sogar Empathie füreinander empfinden, obwohl doch nur Stellvertreter-Avatare aufeinandertreffen. Schon der Aufbau von Virtuellen Realitäten (VR) und die Genese ihrer Entwicklung sagen sehr viel darüber aus, so Pirker, wie Menschen sich und ihre reale Welt wahrnehmen und gestalten, welche Schlüsse sie aus Erfahrungen ziehen und was uns Menschen überhaupt antreibt.
Spielen – so wertvoll, wie ein gutes Buch zu lesen
Wie das aussehen könnte, hat sie in ihrem Projekt „Maroon“ schon einmal durchgespielt. Beim Aufbau dieser dreidimensionalen, immersiven Virtuellen Realität verwendete sie erprobte Spiele-Technologien, um zum Beispiel ein Physik- oder Computer Science Labor zu simulieren. „Maroon“ wurde so zu einem interaktiven Physiklabor im Virtuellen Raum. Die VR-Plattform steht nun für aktives Lernen im Klassenzimmer oder zu Hause zur Verfügung. Sie visualisiert und simuliert Experimente mit einem Schwerpunkt auf Physik-Versuchen, etwa mit dem Van der Graaf-Generator. Seit 2013 hat sie daran gearbeitet, seit 2018 wird sie in österreichischen Schulen getestet.
„Ein gutes Spiel zu spielen ist für mich genauso wertvoll, wie ein Buch zu lesen“, sagt Pirker. Spiele seien in der Lage, für „sehr mächtige Erfahrungen“, zu sorgen. Ständig müsse man dabei Entscheidungen selbst treffen. Deshalb nennt sie Spiele auch „Empathiemaschinen“. Erstaunlicher für sie ist daher, dass sich weltweit nur sehr wenige Forschende akademisch damit beschäftigen. Pirker, neben ihrer Vertretungsprofessur an der LMU auch Softwareingenieurin und Forscherin am Institut für Interaktive Systeme und Datenwissenschaften an der Technischen Universität Graz (TUG), wollte das schon während ihrer Masterarbeit am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ändern, wo sie über kollaborative virtuelle Welten forschte und im Jahr 2017 ihre Doktorarbeit in Informatik über motivierende Umgebungen abschloss.
Besser zum Lernen und Zusammenarbeiten motivieren
In der Informatik habe sie mit der Zeit alle ihre anderen Lieblingsfächer wiedergefunden, sagte Pirker in einem Interview auf der Website der ETH Zürich: „Ich habe mit Physikern und Chemikerinnen, mit Künstlern, Musikerinnen und Psychologinnen zusammengearbeitet. Ich mag auch den kreativen Aspekt: Ich kann nicht gut zeichnen oder Geschichten erzählen, aber durch das Programmieren kann ich die Welten in meinem Kopf für andere zugänglich machen.“ Sie hat sich auf Spiele und Umgebungen spezialisiert, die Benutzer durch motivierende Aufgaben zum Lernen, Training und Zusammenarbeiten anregen.
Pirker kann dabei auf ihre langjährige Erfahrung im Bereich Game Design und Entwicklung sowie in der Entwicklung virtueller Welten zurückgreifen. So arbeitete sie in der Videospielbranche bei „Electronic Arts“, einem multinationalen Tycoon der Szene. Seit 2016 organisiert sie die jährlichen „Game Dev Days Graz“, die größte österreichische Konferenz für Spieleentwickler.
„Wenn wir uns in der virtuellen Welt bewegen, können wir dort ohne Ablenkung lernen. In so einer leeren Welt bin ich wir auf meiner einsamen Insel und kann dort konzentriert arbeiten.“
In ihrer Forschung beschäftigt sie sich nicht mehr nur mit Spiele-Engines, sondern möchte den digitalen Raum auch um die Implementierung von KI erweitern. Hinzu kommen ihre Erfahrungen mit Datenanalyse, interaktiven Umgebungen, und auch mit der Historie der Computer-Spiele. Aus all dem entwickelt sie Gamification-Strategien für die Lösung aktueller Probleme und zudem Methoden des E-Learning für die Arbeit mit Schülern, Schülerinnen und Studierenden.
Wie auf einer einsamen Insel
Das ist das ziemlich breit aufgefächerte Spektrum der Wissenschaftlerin, die vor nicht allzu langer Zeit vom Magazin Forbes zu den 30 wichtigsten Forscherinnen Europas unter 30 gezählt wurde. Was Pirker motiviert, beschreibt sie in Kürze so: „Wenn wir uns in der virtuellen Welt bewegen, können wird dort ohne Ablenkung lernen. In so einer leeren Welt bin ich wie auf meiner einsamen Insel und kann dort konzentriert arbeiten. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass ich das Digitale brauche, um vom Digitalen wieder in die Realität, etwa der Physik zu kommen.“

Als langjährige Kennerin der Spieleszene war Pirker irgendwann ermüdet von uninspirierten Spielen, die von den immer gleichen Entwicklern stammten, immer wieder zu den gleichen Genres und Formaten zurückkehrten. „Obwohl ich alle großen Titel kannte, erkannte ich einen großen blinden Fleck: Die Titel wurden alle von denselben Studios in den gleichen Ländern entwickelt, und sie erzählten alle ähnliche Geschichten.“ So entstand das Projekt „A Year of Playing the World“, in dem sie versuchte, Spiele aus jedem Land der Erde zu finden: unabhängige Entwicklungen, die sie neue Erfahrungen machen ließen, was Spiele sein können und wie anders sich auch die Weltwahrnehmung der Menschen darin spiegelt.
„Ich wollte mich aus meiner Komfort-Zone pushen“, sagt Pirker. Sie stieß auf Spiele etwa aus Afghanistan, Bolivien, Kuba, Frankreich, Burundi, aus Namibia oder Norwegen, die sie sämtlich ausprobierte, egal aus welchem Genre. „Das war für mich wirklich eine der besten Erfahrungen, auch weil ich plötzlich verstanden habe, wie viel Kultur aus den jeweiligen Ländern in den Spielen drin ist.“ Sie berichtet von den darin entdeckten, hier unbekannten Bräuchen, Mythologien, Ritualen und Umwelten – von einem intrinsischen Allgemeinwissen also, das den regionalen Bezug und damit auch die Mentalität einer Kultur repräsentiert, schon in der Erzählweise und der Art der Charakterzeichnung, der Kleidung, der Spielmechanik.
Die Spieleentwicklung, sagt Pirker, ist seitdem nicht stehen geblieben, sie ist nicht mehr ausschließlich den großen Playern mit ihrem Expertenwissen und großen Studios im Hintergrund überlassen. Das Medium ist diverser geworden, die Spiele künstlerischer, vielleicht auch gesellschaftskritischer, zugänglicher für neue Erzählformen. „Auch ein Philosoph kann nun seine eigene Idee mit einem Videospiel verwirklichen.“ Längst arbeiten aber auch Berufsplattformen und Hersteller von Lernsoftware mit Elementen aus Spielen. Man spricht von Gamification, die bewirken soll, dass Personen in spielerischer Weise miteinander in Verbindung treten oder aber herausgefordert werden, sich zu engagieren und intensiver zu lernen. „Hier können wir nun Lernumwelten kreieren, die verschiedene Themen in die Gesellschaft bringen und zum Wissenserwerb motivieren.“
Vor allem in VR sieht die Forscherin dabei großes Potential. In einer 2021 veröffentlichten Studie wies Pirker nach, dass Studierende mittels immersiver, realitätsnaher Visualisierungstechniken „eine höhere Aufmerksamkeit, bessere Verarbeitung von Lerninhalten und positivere Erfahrungen mit den Lehrstoffen empfinden als in traditionell-analogen Desktop-Umgebungen.“ Eine weitere Studie ergab, dass Visualisierungen und Animationen gut dabei helfen können, Wissen zu vermitteln, indem sie es konkreter machen: „Insbesondere kann VR neue Formen der Interaktion ermöglichen, die motivierend wirken, eine hohe emotionale Beteiligung anregen und die Wahrnehmung schulen.“
Konzentration auf die Lernerfahrung
Allerdings scheinen nicht alle Studierenden gleichermaßen auf synthetische Welten zu reagieren, wenn Gamification in die Lehre implementiert wird. „Es gibt auch dabei offenbar völlig unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Studierende, die voll motiviert sind durch eine Competition und Rankings. Andere können wiederum ohne Ranking besser lernen. Es demotiviert auch manchmal, wenn sie einfach lieber für sich lernen wollen“, sagt Pirker. „Studierende sollten sich in digitalen Welten völlig auf die Lernerfahrung konzentrieren können.“
Pirker ist fest davon überzeugt, dass die Entwicklungen in der Spieleindustrie eine Vorreiterrolle bei der motivierenden Vermittlung für all jene klassischen Medien übernommen hat, die sich bislang als Produzenten analoger Produkte begriffen haben: Die Film- und Fernsehindustrie, Verlagshäuser und auch Schulen und Universitäten. „Wir haben im Physik-Unterricht und in vielen MINT-Fächern, also Mathematik, Natur- und Ingenieurswissenschaften, immer das Problem, dass viele Experimente zwar super spannend sind, aber die meisten Schulen und Universitäten sich reale Experimentierlabore nicht leisten können. Darum ist der Physik-Unterricht leider oft sehr trocken und theoretisch“, sagt Pirker. Simulationen oder Visualisierungen könnten Schülern Phänomene der Physik leichter veranschaulichen. „Integrieren wir das Ganze in Virtual Reality oder in soziale, virtuelle Welten, werden Phänomene hier nicht nur sichtbar, sondern auch anfassbar“, sagt die Medieninformatikerin. Und das sei viel effektiver und motivierender fürs Lernen.
So berichteten Studierende laut Pirkers Untersuchung in der „Maroon“-Umgebung davon, dass dort die VR-Physik-Experimente etwa zum Faraday’schen Käfig oder zum Strömungsverhalten von Flüssigkeiten eine Bereicherung für den Unterricht darstellen. Johanna Pirker sieht sich so gewissermaßen „an der Schnittstelle“ vieler Forschungsbereiche, bei ihr gehen Informatik und Pädagogik Hand in Hand. Sie sei dabei „Informatikerin genug“, um zu wissen, was passieren kann, wenn man hochkomplexe Fragestellungen nur mit Experten aus einem einzigen Fachgebiet angehen und lösen möchte. Fest steht für sie, dass Spiele „Lebenslabore“ sein können. „Über Spiele lassen sich Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden, die alles andere als ein Spiel sind.“
Bernd Graff
Prof. Dr. Johanna Pirker
ist derzeit Vertretungsprofessorin für Medieninformatik an der LMU. Außerdem ist sie Assistant Professor am Institut für Interaktive Systeme und Datenwissenschaften an der Technischen Universität Graz (TUG).


















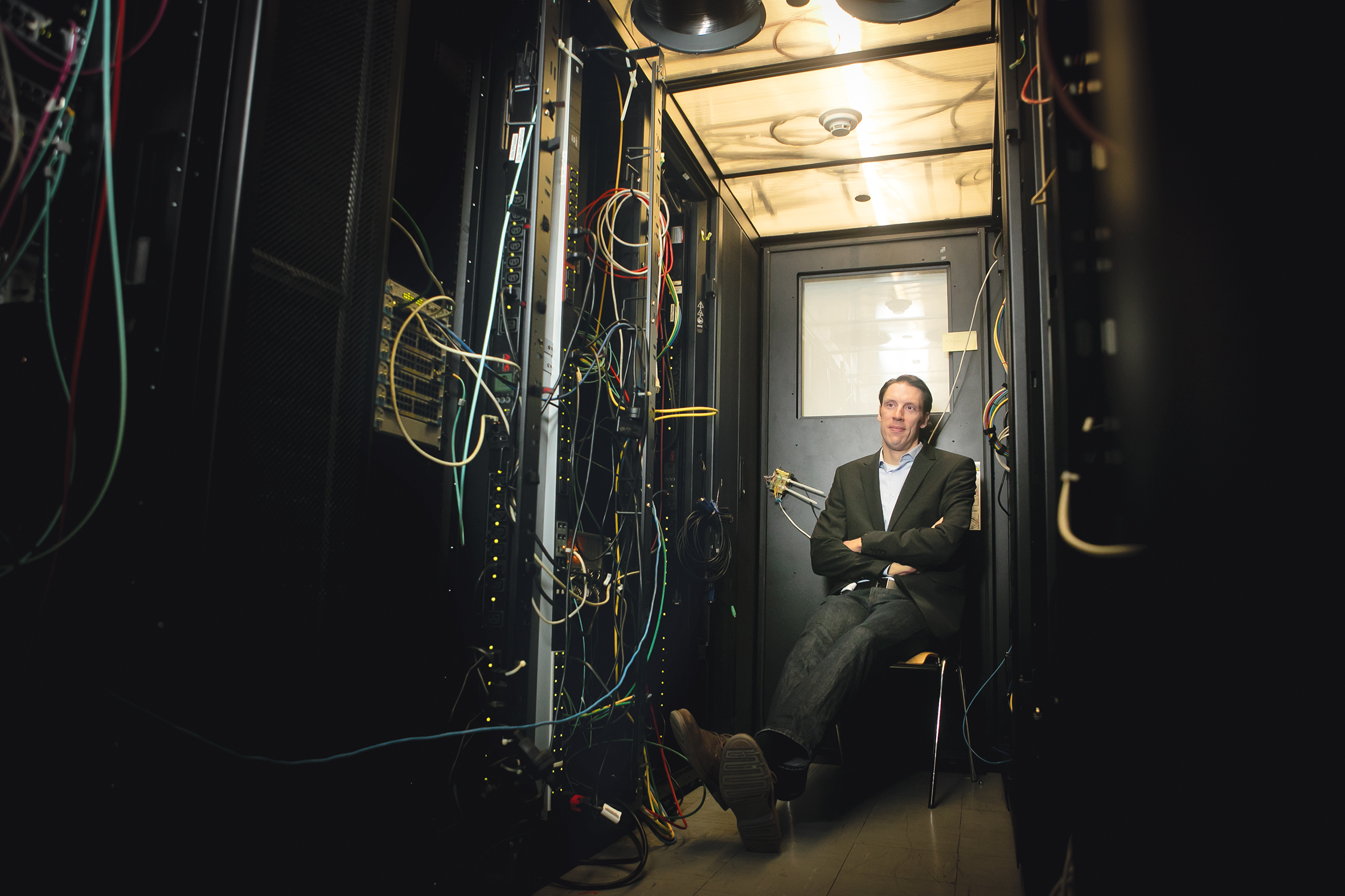





0 Kommentare