Schmerzen, Luftnot, Müdigkeit, Angst: In einem fortgeschrittenen Stadium sind unheilbare Krankheiten eine starke Belastung. Die Palliativmedizin bietet Hilfe auf physischer, psycho-sozialer und spiritueller Ebene. Umso bitterer, dass viele Menschen erst sehr spät palliativ betreut werden, findet Professorin Claudia Bausewein. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am LMU Klinikum und amtierende Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.
MUM: Was ist das Ziel der Palliativmedizin?
Bausewein: Wir wollen Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen ein beschwerdearmes Leben mit guter Lebensqualität ermöglichen.
MUM: Sollten das nicht alle Medizinerinnen und Mediziner tun?
Bausewein: Palliative Betreuung ist zwar die Aufgabe aller, die im Gesundheitsbereich tätig sind, aber in komplexeren Situationen werden Spezialistinnen und Spezialisten gebraucht. Zum Beispiel bei Schwierigkeiten, Schmerzen zu kontrollieren, wenn ständige Übelkeiten auftauchen, ein Tumor immer wieder aufbricht und blutet oder ein Patient wesensverändert ist.
MUM: Lassen sich sämtliche Symptome kontrollieren?
Bausewein: Schmerzen kann man sehr gut lindern. Sie verschwinden zwar nicht unbedingt komplett, aber für die Patienten und Patientinnen ist eine deutliche Linderung meistens akzeptabel. Auf Schwäche und Müdigkeit haben wir weniger Einfluss, weil es dagegen keine Medikamente gibt. Auch Atemnot ist eine große Herausforderung.
MUM: Wird daran geforscht?
Bausewein: Vor zwanzig Jahren gab es fast nichts dazu. Inzwischen liegen viele Studien zum besseren Verständnis der Atemnot und ihrer Therapie vor. Heute können wir Menschen dabei unterstützen, besser mit dem Symptom umzugehen. Und doch bleibt ein großer Forschungsspielraum. Denn neben Opioiden wie etwa Morphin fehlen andere gut wirkende Medikamente.
MUM: Interessiert sich die Pharmaindustrie für das Thema?
Bausewein: Industrieforschung gibt es in der Palliativmedizin so gut wie keine. Dass in Deutschland Förderprogramme für die Palliativversorgung fehlen, erschwert die Situation. Was Förderungen betrifft, stehen wir im internationalen Forschungsvergleich verhältnismäßig schlecht da. Unterstützung finden wir am ehesten bei Stiftungen, also im privatwirtschaftlichen Bereich.
MUM: Was müsste erforscht werden?
Bausewein: Das Themenspektrum, mit dem wir uns befassen, ist extrem breit und umfasst physische, psychosoziale und spirituelle Aspekte. Wichtig wären Studien zur Belastung der Patienten und ihrer Angehörigen und die Frage, wie wir sie unterstützen könnten. Erschreckend wenige Studien gibt es auch zum Thema Symptomkontrolle. In München entwickeln wir gerade eine Komplexitätsskala für Palliativpatienten. Die Frage ist ja, wo die Grenze verläuft: Wer ist ein Palliativpatient? Wann ist ein Fall so komplex, dass wir hinzugezogen werden sollten?
MUM: Haben Studierende und junge Ärzte heute ein besseres palliativmedizinisches Verständnis als früher?
Bausewein: Auf jeden Fall! Jüngere Kollegen haben ein ganz anderes Grundverständnis. Seit zehn Jahren muss jeder Studierende der Medizin einen Schein in Palliativmedizin machen. Wir haben außerdem ein Kommunikationscurriculum entwickelt, um besser über Krankheit, Sterben und Tod sprechen zu können. Außerdem können sich Ärzte und Ärztinnen an unserer eigenen Fortbildungsakademie weiterbilden.
MUM: Noch ist nicht überall bekannt, wie gut man dank der Palliativmedizin auch in der Spätphase einer schweren Krankheit versorgt werden kann…
Bausewein: Der Erfahrungshorizont verändert sich zwar, aber es herrscht noch extrem viel Unwissenheit. Spürbar ist das bei dem aktuellen Thema Assistierter Suizid. Auch weil das Wissen über Unterstützungsmöglichkeiten fehlt, denken viele Menschen, dass das der einzige Ausweg sei.
MUM: Hat sich die Coronapandemie auf die Qualität der Palliativversorgung ausgewirkt?
Bausewein: Einige Palliativstationen wurden geschlossen, Personal wurde abgezogen. Viele Menschen sind sehr einsam gestorben. All das war für uns Anlass, zusammen mit 13 universitären Palliativeinrichtungen in Deutschland im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin Empfehlungen zu entwickeln, wie Palliativmedizin in der Pandemie umgesetzt und gelebt werden sollte.
MUM: Haben die Bilder von Sterbenden auf Intensivstationen uns für die Allgegenwart von Sterben und Tod sensibilisiert?
Bausewein: Das dachte ich anfangs. Normalerweise trifft Sterben und Tod immer die anderen. Plötzlich kam die Pandemie und es konnte jeden erwischen. Aber irgendwann haben wir die Zahlen der Toten einfach hingenommen und über andere Themen gestritten. Ich finde: Da ist eine Chance vertan worden.
MUM: Was würden Sie sich wünschen?
Bausewein: Dass Patienten frühzeitig palliative Hilfe suchen! Leider wird der Begriff palliativ immer noch mit dem Sterben gleichgesetzt. Das hält viele davon ab, zu uns zu kommen. Dabei bestehen viele unheilbare Erkrankungen jahrelang! Patienten, die auf unsere Station kommen, sagen oft: „Hier wollte ich nie landen.“ Und zwei Tage später: „Wäre ich doch früher gekommen!“ Ich finde das extrem bitter. Wir könnten den Patienten so viele Belastungen ersparen! Mir wäre es am liebsten, Patienten zwei- oder dreimal auf der Palliativstation zu sehen. Wir helfen ihnen, sie gehen heim. Und wenn sie wieder Unterstützung brauchen, kommen sie wieder beziehungsweise werden auch im ambulanten Bereich längerfristig durch ein Palliativteam begleitet.
MUM: Ist das Angebot an palliativer Unterstützung in Deutschland groß genug?
Bausewein: Insgesamt sind wir, was Palliativstationen und spezialisierte ambulante Palliativversorgung angeht, im ganzen Bundesgebiet ziemlich gut aufgestellt. Anders ist das bei den Palliativdiensten in Krankenhäusern. Aus fachgesellschaftlicher Sicht sollte jedes Krankenhaus einen solchen Dienst haben, in dem ein Team aus Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern und Psychologen schwer kranke Menschen auf allen Stationen betreut. Hier herrscht ganz großer Nachholbedarf.
> Interview: goe

Um ihr Fach einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, hat Claudia Bausewein mehrere Bücher geschrieben, darunter „Sterben ohne Angst“ (Koesel) und mit Rainer Simader „99 Fragen an den Tod. Leitfaden für ein gutes Lebensende“ (Droemer).


















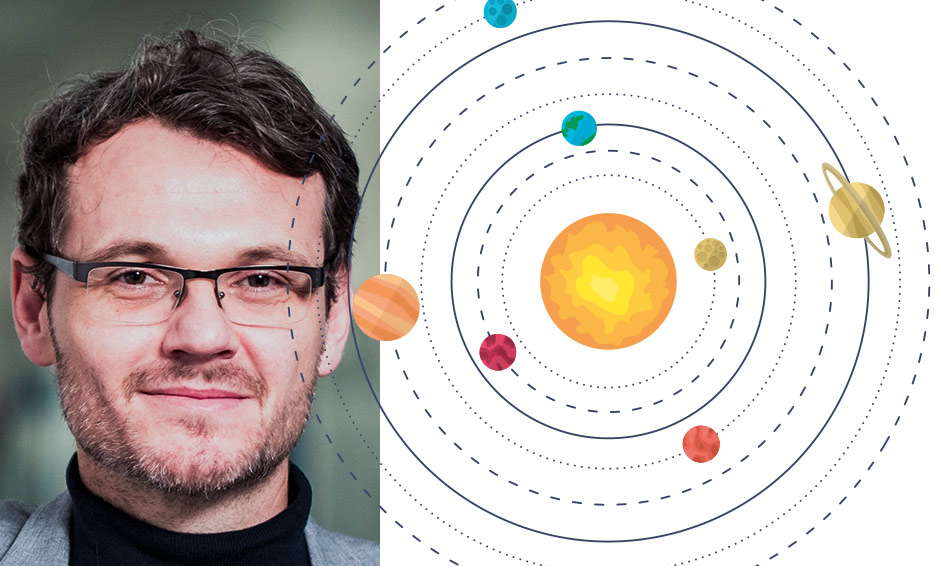

0 Kommentare