Forschende der LMU sind nicht nur fleißig dabei, wissenschaftlich zu publizieren. Einige von
ihnen haben neben Sachbüchern auch schon Romane, Krimis oder Lyrik veröffentlicht oder planen dies. Themen gibt es offenbar genug und die Lockdowns der vergangenen Monate konnten den Schreibfluss beschleunigen.
Markus Ostermair:
Der Sandler – Obdachlosigkeit als Endpunkt eines längeren Scheiterns
Penner, Clochard, Vagabund, Landstreicher, Stadtstreicher – laut Wikipedia alles Begriffe, mit denen Obdach- oder Wohnsitzlose hierzulande bezeichnet werden. Alles Begriffe, die einen negativen Beigeschmack haben, aber die zu kritisieren oder abzuschaffen sich niemand berufen fühlt. Warum? Weil die Gruppe, die mit ihnen benannt wird, keine Stimme hat, faktisch medial nicht stattfindet, es sei denn im Kontext vorweihnachtlicher Spendenfreudigkeit oder wenn Betroffene mal wieder Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind.
Markus Ostermair wollte das nicht länger hinnehmen und dieser Gruppe eine Stimme geben. Der Sandler – ein weiterer, süddeutsch-österreichischer Begriff für die Menschen auf der Straße – heißt sein Roman: Auf dem Titel ein Körper mit Mantel und Rucksack, die Hände in den Taschen … Was fehlt, ist mit dem Kopf der Körperteil, der die Persönlichkeit des Menschen ausmacht und seine Fähigkeit, sich zu artikulieren.
„Ich fand immer unbefriedigend, wie über diese Menschen berichtet wird. Zeitungs- oder Fernsehberichte bleiben formatbedingt an der Oberfläche und die Recherche ist immer schon mit einem Verwertungsgedanken verbunden. Deswegen denke ich, Fiktion kann mehr über sie erzählen als die vermeintlichen authentischen Berichte aus erster Hand“, ist sich Ostermair sicher.
Sein „Antiheld“ ist der ehemalige Mathematiklehrer Karl Maurer, der durch einen tragischen Unfall, bei dem ein Kind stirbt, ins gesellschaftliche Abseits rutscht, seine Familie verliert und fortan „auf Platte“ seinen Alltag abzusitzen hat. Es ist ein Alltag der Demütigungen, Brutalitäten, der Suppe mit Semmel in Hilfseinrichtungen und der Beziehungen zwischen den Wohnungslosen, die sich ihre Situation schönlügen, kurz ein Alltag, in dem, wie Markus Ostermair betont, „nicht viel passiert“. Es gibt hier keine Erfolgserlebnisse und keine Gesprächsanlässe, die etwa Job oder Familie bieten.
Den Alltag von Obdachlosen in den Fokus zu stellen, sagt er, sei eine Gratwanderung, denn die Lesenden „sollen die Langeweile dieses Alltags zwar spüren, aber ohne sie selbst zu empfinden“.
„Die Fiktion erlaube es dem Autor aber, den Plot so zu modulieren, dass die Spannung dennoch gegeben ist und die Ereignislosigkeit des Alltags überwunden wird. Nämlich dann, wenn Karl plötzlich die Aussicht auf eine eigene Wohnung hat, die ihm ein „Leidensgenosse“ als Eigentum überlassen möchte. „Natürlich muss diese Modulation glaubwürdig und nachvollziehbar sein“, sagt Ostermair.
Es scheint geklappt zu haben, denn für seinen Roman Der Sandler wurde Ostermair der renommierte Tukan-Preis der Stadt München sowie der Bayerische Kunstförderpreis 2021 zugesprochen. Und die Armutskonferenz des Landes Baden-Württemberg hat ihm den Gregor-Gog-Preis verliehen. „Ich habe mich sehr über diesen Preis gefreut“, sagt Ostermair, „weil in der Jury viele Betroffene sitzen, die sich in dem Roman wiedergefunden haben.“
Recherche im eigentlichen Sinne hat der Germanist nicht betrieben, eher auf Erfahrungen gesetzt. „Ich habe Zivildienst bei der Münchner Bahnhofsmission geleistet und ehrenamtlich dort gearbeitet. So hatte ich viel Gelegenheit, die Menschen dort zu beobachten“, sagt er, der zusammen mit Professor Clemens Pornschlegel schon seit mehreren Jahren die Studierendenkurse an der LMU im Rahmen der Bayerischen Akademie des Schreibens betreut.
Diese Menschen ohne Bleibe lebten voller Scham und Sprachlosigkeit in einer Leistungsgesellschaft, in der man – so die allgemeine Grundannahme – unmöglich schuldlos in eine solche Situation geraten kann. Und wenn doch, man sich gefälligst selbst wieder daraus befreien zu habe. „Mich hat diese politisch gewollte Individualisierung immer gestört. Sie hat das Bild produziert, auf dem der arme Mensch jemand ist, der in der sozialen Hängematte liegt.“ Und genau hier sieht der Germanist die Literatur in der Pflicht: „Sie muss hinsehen, wo Sprach-losigkeit herrscht beziehungsweise produziert wird!“

Michael Schrödl:
Don Arturo – Herr der Schnecken
Miguel war 24 und brauchte die Nacktschnecken
Obdach hatte Professor Michael Schrödl während seines El-Niño-Studienjahres Anfang der 1990er-Jahre im chilenischen Concepción zwar schon, auch wenn es allenfalls vor Wind geschützt haben mag. Denn es war kalt in den vier Wänden seiner studentischen Bleibe, zwischen sechs und acht Grad Celsius, dazu feucht: „Das Wasser lief von den Wänden“ und an Privatsphäre war schon gar nicht zu denken. Dazu kam die Sprachlosigkeit: „Ich hatte es versäumt, im Vorfeld angemessen Spanisch zu lernen, weil ich glaubte, mich zur Not immer mit Englisch durchschlagen zu können.“ Das stellte sich als Fehlannahme heraus, denn nicht nur seien Englisch-Skills bei den Chilenen praktisch nicht vorhanden gewesen. Es wurde zudem noch ein Dialekt gesprochen, der mit dem Sprachkursspanisch nicht viel zu tun hatte.
Immerhin war die Erlebnisdichte an der „Conce“, wie Schrödl die Universität Concepción nennt, so ausgeprägt, dass er damals schon dachte: „Darüber muss ich mal ein Buch schreiben.“ Im Jahr 2020, fast 30 Jahre nach seinem Aufenthalt in dem südamerikanischen Land, war es dann endlich soweit. Mit Don Arturo – Der Herr der Nacktschnecken. Ein Artenforscher-Roman aus Chile hat der Leiter der Weichtiersek-tion an der Zoologischen Staatssammlung und Professor an der LMU nach einer Reihe von Sachbüchern seinen ersten Roman vorgelegt. Darin erlebt sein Alter Ego, der deutsche Biologiestudent Miguel, ein Chile im Wandel, den ungeheuren Konkurrenzdruck an der Uni und in der Gesellschaft als Nachwehen der Pinochet-Diktatur und eben das nasse und kalte Wetter im El-Niño-Jahr in der Region um Concepción. Das hatte schon einen Vorgänger von ihm, den deutschen Zoologen Eduard Friedrich Pöppig, im Jahr 1828 an den Rand einer Depression gebracht.
Aber das Buch ist vor allem auch eine Liebeserklärung an das Land, das ihm anfangs zwar einiges abforderte, ihm aber auch mit seiner unglaublichen Naturschönheit – etwa die Blumenpracht in der Atacama-Wüste nach seltenem intensivem El-Niño-Regen – tief beeindruckt hat. Und das Land hat seiner wissenschaftlichen Leidenschaft – der Schneckenforschung – wichtige Impulse gegeben.
Mit Biodiversitot und Unsere Natur stirbt hat Schrödl bereits zwei Sachbücher veröffentlicht, die das Artensterben und die Bedeutung der Artenforschung in den Fokus setzen. Auch in Don Arturo klingen diese großen Probleme immer wieder an, wenn etwa die Verschmutzung des Meeres durch die aufstrebende chilenische Industrie, die ihre Abwässer ungeklärt in die Bucht von Concepcion spült, thematisiert wird – mit der Folge eines riesigen Artensterbens und Vergiftung des Meeresgetiers. Student Miguel schwört im Roman: Niemals, wirklich niemals würde er auch nur ein Stückchen Meeresgetier aus der Bahía de Concepción anrühren!
„Das Artensterben ist ein ebenso großes Problem wie der Klima-wandel“, betont Michael Schrödl. „Nur haben es Wenige auf dem Schirm. Artenschutz geht aber nur mit Artenforschung.“ Die, sagt der Taxonom, gehöre endlich ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses und der Fördertöpfe.
Dafür möchte er sensibilisieren – und das nicht nur in Sachbüchern, die für eine breite Öffentlichkeit geschrieben sind. „Man kann nicht alle Menschen mit den teilweise schon frustrierenden Fakten erreichen.“ Verpackt in einem sehr launig erzählten Roman hofft er, für sein Anliegen auch diejenigen Leserinnen und Leser zu sensibilisieren, die einfach eine spannende und lustige Geschichte hören oder lesen möchten.
Und außerdem: „Ich wollte einfach mal etwas Verrücktes schreiben“, lacht Schrödl und hat die erzwungene Reiseuntätigkeit während des Corona-Lockdowns genutzt, um den Roman zu vollenden. „Das Schreiben war für mich wie Fremdreisen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.“ Auch das nächste Romanprojekt, gleichsam die Fortsetzung von Don Arturo, ist schon gesetzt: Verspottet, abgebrannt, von inneren Dämonen gequält: die Umweltmafia hetzt Nacktschnecken-Doktorand Miguel durch halb Südamerika.

Sophia Klink:
Lyrik als Experimentierfeld
Nichtselbst
Ich erfinde Schlösser
in die alle Schlüssel passen
die der Pilze und Pollen
und wer noch in meine Zellen will
sie winken mir zu
und es sieht aus als ob
sie mit weißen Fahnen winken
ich unterscheide nicht mehr
zwischen Feind und anderen Freunden
baue alle Rezeptoren ab
die mich falsch verschlossen haben
bis sogar die Erdnussepitope
Hausstaubschlüsselbärte
zu meinen Identitätskomplexen passen
nur manche Bakterien sagen
sie müssten noch ihre eigenen
Allergien kurieren bevor sie
unseren Friedensvertrag
unterzeichnen
Experimente prägen die wissenschaftliche Arbeit von Sophia Klink. Aber auch ihre Lyrik sieht sie als Versuchsfeld, um nicht nur das poetische Potenzial aus wissenschaftlichen Fachbegriffen zu extrahieren und auf andere Weise lebendig zu machen. Sie will auch ihre beiden Leidenschaften – die Biologie und die Schriftstellerei – fruchtbringend miteinander verbinden.
„Ich möchte Fachtermini für das Poetische greifbar machen“, sagt sie. Das sei auch klanglich sehr interessant. Natürlich berge das die Gefahr, dass naturwissenschaftlich unbefangene Leserinnen und Leser nichts damit anfangen können. „Es hängt natürlich von der Lesepräferenz ab, und es gibt sicherlich Leute, die beim Begriff Enzym schon aussteigen. Einige Dinge muss ich aber als bekannt voraussetzen“, sagt Klink.
Neben Gedichten ist sie im Gebiet der Prosa unterwegs. Bereits mit zehn hat sie ihren ersten Roman begonnen, derzeit arbeitet sie an einem weiteren Romanprojekt. Und wie beim Artenforscher Michael Schrödl geht es um Forschung in fernen Ländern, genauer – auf Kamtschatka. „Ich war selbst auf einer russischen Forschungsstation und die wunderschöne Landschaft hat mich inspiriert, dieses Setting für meinen dritten Roman zu wählen.“ Auch bei ihr ist der Subtext die menschengemachte Zerstörung der Natur unter anderem durch die Klimakrise. Aber Klink hat den Roman auch als eine ethische Auseinandersetzung mit dem Thema Forschung generell angelegt: Was machen wir hier eigentlich?, Warum töten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst immer wieder für ihre Arbeit?, Was ist gut, was schlecht? – das alles sind Selbstreflexionen, die die Protagonisten, ein Forscherteam im äußersten Osten Russlands, beschäftigen werden.
Die Doktorandin, die am Helmholtz Zentrum zur Kommunikation zwischen Pflanzen und Wurzelbakterien promoviert, erhielt mit Anfang 20 ein Literaturstipendium der Landeshauptstadt München. „Das war prima, um einen Fuß in die Tür zu bekommen.“ Geholfen, sagt sie, hätten ihr auch die Schreibkurse der Bayerischen Akademie des Schreibens. So besuchte sie bereits ein Romanseminar und konnte auch ihre Fähigkeiten im Bereich „Nature Writing“ ausbauen. „Das ist ein großes Thema, das immer mehr Bedeutung gewinnt. Und die Kurse der Schreibakademie sind eine fantastische Möglichkeit, zu lernen und mit anderen Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.“
Sophia Klink bekommt beides – Promotion und Schreiben – gut unter einen Hut, kann sich aber nicht vorstellen, das Schreiben der Wissenschaft zu opfern. „Ich würde es nie aufgeben“, ist sie sich sicher. Aber die beiden Bereiche verdrängen einander ja auch nicht. Im Gegenteil soll ein zukünftiges Romanprojekt auf ihrer Doktorarbeit basieren. „So kann ich meine Recherche für die Dissertation hervorragend als Basis nutzen“, freut sie sich.
Was sie schade findet ist, dass viele ihrer Naturwissenschaftskollegen und -kolleginnen wenig auf künstlerische Ansätze geben. „Es geht vor allem um harte Fakten, obwohl doch so viel mehr drinsteckt. Ich glaube schon, dass man in den Naturwissenschaften über die Künste eher lächelt, nach dem Motto: ‚das ist ja alles schön und gut für den Zeitvertreib, aber eigentlich nicht wirklich relevant‘.“ Sie selbst wünscht sich etwa für das Biologie-Curriculum auch mehr philosophische und ethische Inhalte. „Ich hatte lediglich ein Seminar während meines Studiums, in dem es um ethische Aspekte ging. Das ist zu wenig.“
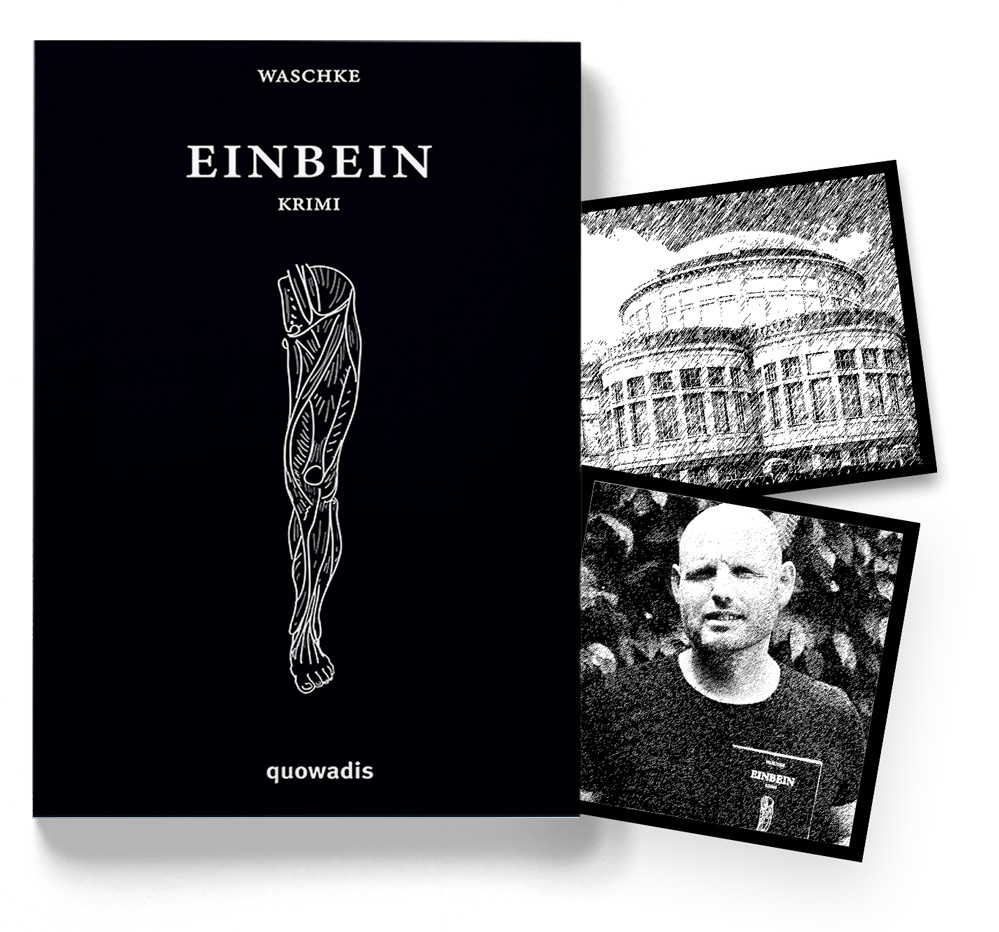
Jens Waschke:
Mit Einbein im Krimi-Genre
Die ethische Komponente spielt auch im Krimi von Jens Waschke, Ordinarius für Anatomie an der LMU, eine gewichtige Rolle.
Protagonist in Einbein ist der etwas schrullige, manchmal desillusioniert wirkende Anatomieprofessor Nodus, der eines Tages ein menschliches Bein vor dem Liefereingang der LMU-Anatomie in der Pettenkoferstraße findet – fachgerecht abgetrennt und präpariert. Dahinter, so zeigt sich, steckt der internationale, zum Teil mit zutiefst kriminellen und menschenverachtenden Methoden arbeitende kommerzielle Handel mit menschlichen Präparaten für die unterschiedlichsten Zwecke. Und Nodus – lateinisch für „Knoten“ – findet sich plötzlich in einem lebensgefährlichen Geflecht krimineller Machenschaften rund um Körperpräparate wieder und muss sich schließlich sogar zwischen Körperspenden in einer riesigen Küvette verstecken…
Klar, dass ein Anatom einen Krimi schreiben muss, mag man denken. Dieser Meinung liegt die Gleichung: Arbeit an Körpern Verstorbener = Verbrechen = Krimi zugrunde, die so einfach wie falsch ist. Denn die Arbeit von Fachwissenschaftlern, die mit den Körpern toter Menschen arbeiten, ist sehr ausdifferenziert – eine Tatsache, die auch im Fernsehkrimi immer wieder aus dem Blick gerät. Es gibt die Rechtsmediziner, die helfen, Gewaltverbrechen oder unnatürliche Todesfälle aufzuklären, und damit noch am ehesten eine Affinität zum Genre zeigen. Es gibt die Pathologen, die vor allem zu krankheitsbedingten Vorfällen und Zuständen in menschlichen und tierischen Körpern forschen. Und es gibt die Anatomen, deren Hauptfokus neben der Forschung vor allem die Lehre, also die Ausbildung von Nachwuchsmedizinern ist.
Aber der begeisterte Jo-Nesbø-Leser Jens Waschke wollte schon länger einen Krimi schreiben, nachdem er vor allem Lehrbücher verfasst und mit Einfach genial. Die Anatomie von Locke bis Socke ein Buch für das Nicht-Fachpublikum veröffentlicht hat. „Die Idee für die Figur Nodus hatte ich schon eine Weile“, erinnert sich Jens Waschke. „Ich wollte einfach ein richtiges Original zeigen – wie sie der Wissenschaftslandschaft leider größtenteils abhandengekommen sind“, sagt er. „Aber eine Figur gibt ja noch keine Geschichte.“ Der weltweite Handel mit Präparaten, ein sehr intransparentes Geschäft und ein aktuelles Problem, bildete dann den willkommenen Rahmen für den Protagonisten – einen Wissenschaftler und Genussmenschen, der nicht nur seinen Beruf, sondern auch Rippchen in Biergärten und Grießklößchen aus Tütensuppen liebt – ungekocht, versteht sich – und gerne am Maisinger See im Van übernachtet und vor allem seinen Beruf sehr liebt. Nodus ist bereits in seinen 60ern und schon rein altersmäßig kein Alter Ego von Jens Waschke. Wenngleich einige Angewohnheiten und Vorlieben durchaus kongruent sind: zum Beispiel die gemeinsame Vorliebe für besagte Grießklößchen oder die Band Sisters of Mercy.
„Im Krimi kritisiert Nodus das ganze Lehrbuchwesen und die Forschungsgepflogenheiten. Da vertrete ich eine ganz andere Meinung als er“, hebt Waschke die Unterschiede zwischen Protagonist und Autor hervor. „Es stimmt schon alles, was er anspricht, aber die Welt ist doch etwas komplexer, als er sie darstellt“, lacht der „echte“ Anatom. Aber das Wichtigste, was er mit seinem Buch auch transportieren wollte: „Es soll eine Liebeserklärung an unser Fach sein.“
Kostenkontrolle und viel Arbeit
Seinen Krimi hat Jens Waschke im Selbstverlag, neudeutsch „Selfpublishing“ herausgebracht: „Ich wollte nicht immer nur auf die Verlage schimpfen, sondern es selbst versuchen – und es ist verdammt viel Arbeit“, sagt er. Um alles muss man sich selbst kümmern: Lektorat, Layout, Vertrieb. Apropos Vertrieb: „Die meisten Bücher habe ich verschenkt. Das wirkt bei einem Krimi nicht so oberlehrerhaft, wie wenn man ein Lehrbuch verschenkt“, schmunzelt er. Verkauft hat er immerhin auch schon rund 200 Exemplare – von 1.000. „Ohne regelrechtes Marketing ist das gar nicht schlecht“, sagt er und gibt zu: „Geld verdienen kann man damit aber nicht.“
Auch LMU-Professor und Buchautor Michael Schrödl setzt schon länger auf den Selbstverlag. „Der Vorteil ist, dass man die volle Kontrolle hat“, sagt er. Natürlich sei es viel Arbeit. Aber er hat einen Book-on-Demand-Dienstleister eingeschaltet, der die Gestaltung und den Druck übernommen hat, zudem hat Schrödl noch ein professionelles Lektorat finanziert. Was ihm wichtig ist – dass er die Einnahmen komplett behalten und vor allem einen Euro pro verkauftem Buch seiner Stiftung zum Artenschutz zukommen lassen kann. „Das ginge bei einem Verlag nicht. Da kann man froh sein, wenn man selbst einen Euro aus dem Erlös erhält.“ Natürlich, reich wird er damit nicht. Will er ja auch gar nicht: „Ich möchte vor allem Bewusstsein schaffen und Menschen sensibilisieren.“
Sophia Klink hat bisher noch keines ihrer Bücher veröffentlicht. Kontakte hat sie aber schon mehrere, und gute Referenzen kann sie ja unter anderem mit dem Literaturstipendium vorweisen.
Aber ob Verlag oder nicht, Stipendium und Preis oder nicht: Sophia Klink, Markus Ostermair, Michael Schrödl oder Jens Waschke – das literarische Œuvre der vier Forschenden lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen: die Freude daran, gute Geschichten zu erzählen.
Markus Ostermair: Der Sandler
https://kurzelinks.de/der-sandler
Jens Waschke: Einbein;
https://kurzelinks.de/einbein
Michael Schrödl: Don Arturo – der Herr der Nacktschnecken
https://kurzelinks.de/don-arturo > www.artenforschung.de

















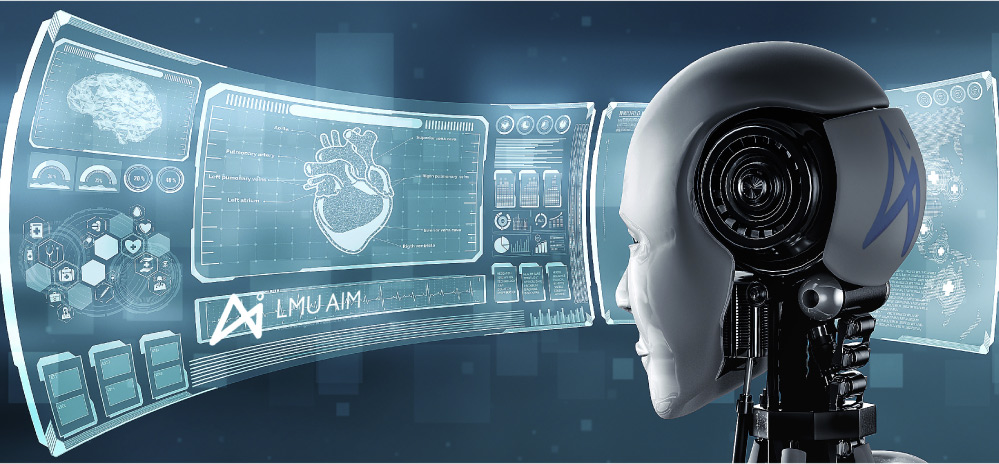

0 Kommentare