
KI als Zukunftstechnologie:
Professorin Ines Helm erforscht den Strukturwandel des Arbeitsmarkts
Neu an der LMU, befasst sich die Ökonomin mit Effekten des technologischen Fortschritts.
Welche Aufgaben werden künftig Algorithmen übernehmen? Wie wird sich das auf den Stellenmarkt auswirken? Und was bleibt dem Menschen dann noch zu tun? Mit Fragen wie diesen befasst sich die Ökonomin Ines Helm. „Die Umwälzung des Arbeitsmarkts durch Künstliche Intelligenz (KI) hat gerade erst begonnen, weshalb die arbeitsmarktökonomische Erforschung ihrer Effekte noch in den Kinderschuhen steckt.“ Helm ergründet unter anderem, welche Schlüsse sich aus früheren Umwälzungen durch technologischen Wandel, wie Automatisierung, Computerisierung und Robotisierung, auf den Wandel durch KI ziehen lassen.
Seit Oktober vergangenen Jahres hat die Expertin für Arbeitsmarkt-ökonomik eine Professur für KI in der Volkswirtschaftslehre an der LMU inne. Neben Arbeitsmarktökonomie zählen auch die Regionalökonomie, Finanzwissenschaften sowie angewandte Methoden zu ihren Forschungsschwerpunkten. Helm studierte Volkswirtschaftslehre an der LMU sowie der Universität Tübingen und absolvierte einen Master in „Econometrics and Mathematical Economics” an der London School of Economics. 2016 wurde sie am University College London promoviert und im selben Jahr auf eine Assistenzprofessur an die Stockholm University berufen.
„Effekte in der nächsten Dekade“
Ein Fokus von Ines Helm, die 2017 den Young Labour Economist Prize der European Association of Labour Economists erhielt, liegt auf dem strukturellen Wandel. „Technologischer Fortschritt hat schon immer zu großen Umwälzungen am Arbeitsmarkt geführt.“ Die Einführung von KI im Arbeitsmarkt stehe noch ganz am Anfang. „Aber in der nächsten Dekade werden wir ihre Effekte stärker zu spüren bekommen.“ Die Hauptfrage dieses jungen Themas sei im Moment noch, wie sich der Einsatz von KI auf dem Arbeitsmarkt – mit den vorhandenen Daten – überhaupt messen lässt. Zudem gelte es, aus vergangenen Episoden strukturellen Wandels Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
„Sorgen über Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gab es auch bei vergangenen Umwälzungen wie der Mechanisierung der Landwirtschaft oder der Computerisierung.“ Gesamtwirtschaftlich hätten sich die Sorgen aber im Endeffekt nicht bestätigt. „Es ist eben ein permanenter Wandel: Von der Agrargesellschaft sind wir zur industrialisierten Gesellschaft und schließlich zur Informationsgesellschaft übergegangen“, so Helm. „Aber die Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft freigesetzt wurden, trugen am Ende dazu bei, dass Deutschland im Produktionssektor stark wurde. Von der Computerisierung war der Produktionssektor negativ betroffen, brachte aber zugleich einen enormen Anstieg im Dienstleistungssektor.“
KI betrifft hochqualifizierte Beschäftigte
In Bezug auf den vergangenen, auch durch Globalisierung ausgelösten Wandel im verarbeitenden Gewerbe konnte Ines Helm bereits zeigen, dass die Folgen von strukturellem Wandel nicht gleich verteilt sind. Stattdessen verschwanden vor allem gut bezahlte Jobs für Geringqualifizierte vom Arbeitsmarkt. Diese fanden dann nur schwer eine neue Beschäftigung und mussten vermehrt in den schlechter bezahlten Dienstleistungssektor wechseln. Einkommenseinbußen kamen dabei nicht etwa durch erhöhte Verluste in – spezifischem – Humankapital zustande, sondern vor allem, weil Firmen im verarbeitenden Gewerbe produktiver sind und sie ihre Beschäftigten über höhere Löhne an Gewinnen beteiligen.
„Neue Technologien führen auch immer dazu, dass neue Aufgaben entstehen“, so Helm. „Das wird wohl auch bei der KI passieren – mit dem Unterschied, dass KI auch hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt betreffen wird. Diese werden allerdings möglicherweise besser in der Lage sein, sich anzupassen.“
Ein wichtiger Aspekt sei dabei, welche Arten von neuen Technologien durch KI entstehen. „Sind es nur reine Automatisierungstechnologien oder führen diese auch zu Produktivitätssteigerung? Sind sie komplementär zu den Skills der Beschäftigten und führen sie vielleicht auch zu neuen Aufgaben? Und wie bildet man die Arbeitskräfte um, damit sie die neuen Jobs bewältigen können?“
„Komplexe Aufgaben bleiben beim Menschen“
„Wenn ein Radiologe ganz genau auf jeden einzelnen Scan schauen muss, um zu identifizieren, ob ein Patient Krebs hat oder nicht, könnte KI das für den Radiologen stark vereinfachen und dabei sogar genauer sein als der Mensch. Der Radiologe wird zwar trotzdem noch über das Ergebnis und die Scans sehen, kann aber mit der gewonnenen Zeit andere Tätigkeiten seines Berufs besser ausfüllen, was positive Effekte hat.“ Negative Effekte gebe es dagegen bei reiner Automatisierung: „Viele Callcenter-Mitarbeiter werden in der Zukunft sicherlich durch KI ersetzt werden. Aber auch hier bleibt den verbleibenden menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Zeit für komplexere Anfragen. Und das könnte zu mehr Kundenzufriedenheit und einer höheren Nachfrage führen“, so die Ökonomin.
„Ich glaube nicht, dass wir durch KI in Massenarbeitslosigkeit enden, wie manche es jetzt fürchten“, resümiert Helm. „Aber wie bei früheren Umwälzungen wird es Verlierer geben – und wir müssen sehen, wie man ihnen helfen kann.“
Professor Nicola Lercari erforscht Kulturerbe – an der Schnittstelle von Geisteswissenschaften und Informatik
Ruinen in 3D: Nicola Lercari macht mit innovativen Technologien die Vergangenheit sichtbar.
Professor Nicola Lercari setzt Drohnen sowie luft- und bodengestützte Techniken ein, um berühmte Welterbestätten wie die neolithische Siedlung Çatalhöyük in der Türkei oder die antike Maya-Stadt Palenque in Mexiko in 3D zu kartieren und zu dokumentieren. In Palenque nutzten Lercari und sein Team diese sogenannte Light Detection and Ranging (LiDAR)-Technologie, die auf einem Forschungsflugzeug montiert ist, um das Gelände von oben zu erfassen – mit Hunderttausenden von Lichtimpulsen pro Sekunde.
Diese Lichtimpulse erfassen nicht nur die Baumkronen: Einige Impulse ziehen an den Blättern vorbei, treffen auf den Dschungelboden und werden mit Lichtgeschwindigkeit zurück zum Flugzeug reflektiert.
Den Forschern liefern sie sogenannte „Punktwolkendaten“, aus denen dreidimensionale Karten am Computer entstehen. Nimmt man die Vegetation weg, bleiben präzise 3D- sowie digitale Abbildungen von Ruinen, Monumenten sowie historischen Straßen- und Bewässerungssystemen am Boden. „Früher kämpften sich Forscher monatelang zu Fuß durch den Dschungel, um Ruinen zu finden“, erklärt Lercari. „Heute fliegen wir einen Tag lang mit einem mit LiDAR ausgestatteten Flugzeug und finden die Kulturerbestätten später im Labor – oft gleich mehrere davon. Wenn man Drohnen mit LiDAR ausrüstet, eröffnet das noch mehr Forschungsmöglichkeiten, wie etwa die regelmäßige Überwachung von Kulturerbestätten, um Plünderungen zu erkennen oder Schäden zu bewerten.“
Lercari, der seit Januar dieses Jahres den neu eingerichteten Lehrstuhl für Digitale Kulturerbestudien der LMU innehat, bezeichnet sich selbst „als geisteswissenschaftlicher Informatiker“. Der gebürtige Italiener studierte Kommunikationswissenschaften an der Universität Genua sowie Film- and Medienproduktion an der Universität Bologna. Nachdem er dort im Bereich History and Computing mit einer Arbeit zu 3D visualization of cultural heritage data promoviert worden war, wirkte er anschließend fast 13 Jahre lang in den USA, vorrangig an der University of California Merced, wo er zuletzt als Associate Professor for Heritage Studies tätig war, bevor er an die LMU wechselte.
Archäologie und Informatik
Die neue akademische Disziplin „Digitale Kulturerbestudien“ forscht an der Schnittstelle von Kulturerbe, Archäologie, Museumskunde und Informatik. „Ich ergründe mithilfe digitaler und raumbezogener Technologien die Hinterlassenschaften der Vergangenheit, um sie Forschenden und der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Dazu gehören unter anderem historische Gebäude, Städte und archäologische Stätten, aber auch Museumssammlungen sowie immaterielle Bestandteile vergangener Kulturen wie Sprachen und indigene Traditionen.
Sein Institut, das von der Hightech Agenda Bayern gefördert wird, ist gerade wegen des Einsatzes innovativer Technologien einzigartig in der europäischen Hochschullandschaft. Zum Institut gehört das „Heritage Interpretation Visualization and Experience“-Labor (HIVE), das sich neben digitalem Erbe und digitaler Archäologie mit Methoden wie Fernerkundung und Satellitenbildgebung, unbemannten Flugsystemen, 3D-Mapping, Laserscanning, Geodatentechnologie sowie Virtual und Extended Reality befasst.
Bewahrung von Kulturerbestätten durch LiDAR
LiDAR, mit Flugzeugen und Drohnen oder vom Boden aus, wird auch zur Überwachung von historischen Bauwerken genutzt. „Einmal in 3D gescannt, können die Forschenden ein Bauwerk nach einem Erdbeben, einem Brand oder bei natürlichem Verfall erneut scannen und Änderungen der Struktur oder Risse in der Fassade entdecken.“
Zwischen 2015 und 2020 setzte Lercari terrestrisches LiDAR ein, um die Stadt Bodie zu überwachen, eine ikonische Boomtown aus der Ära des Goldrauschs an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Die hölzernen Gebäude und Überreste des dortigen Bergbaus sind aufgrund des Klimawandels zunehmend von Bränden bedroht. Im Falle eines sich schnell ausbreitenden Feuers können präzise 3D-Daten, digitale Karten und aktuelle Lagepläne von Gebäuden, Ruinen oder Objekten, die in der Landschaft verstreut sind, der Feuerwehr helfen, auf die drohende Gefahr zu reagieren und Kulturgüter zu retten.
Mithilfe von LiDAR und drohnengestützter Photogrammetrie dokumentierte Lercari auch die neolithische Siedlung von Çatalhöyük in der Türkei (ca. 7100 bis 5600 v. Chr.), die für das Verständnis der Ur- und Frühgeschichte und der frühen Agrargesellschaften von zentraler Bedeutung ist. „Ich habe sechs Jahre lang jeden Sommer Hunderte von Lehmziegelhäusern gescannt und dann den Verfall ihrer Mauern auf den Millimeter genau berechnet, um Informationen für Erhaltungsmaßnahmen zu sammeln.“ Mithilfe des Geographischen Informationssystems (GIS) setzte Lercaris Team 3D- und Umweltdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit zueinander in Beziehung, um Karten zu erstellen, mit denen die Restauratoren die Ursachen des Verfalls untersuchen und Erhaltungsmaßnahmen planen konnten.
Gegenwärtige und zukünftige Forschung
In Zusammenarbeit mit dem Institute for Digital Exploration (IDEx) der University of South Florida startete Lercari im Juli 2022 ein Projekt in Eloro. Das ist eine griechische Siedlung nahe Syrakus auf Sizilien, die auf das achte Jahrhundert vor Christus zurückgeht.
Eloro war die erste Subkolonie von Syrakus und hatte aufgrund seines Hafens, seines Zugangs zum Fluss Tellaro sowie seiner uneinnehmbaren Befestigungsanlagen eine enorme logistische Bedeutung für die griechische Kolonisierung Ostsiziliens. Die Erforschung von Eloro stützte sich bisher auf Ausgrabungsdokumentationen vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Lercari und sein Team wollen nun mithilfe ihren Technologien einen neuen Blick auf die griechische Kolonisierung Siziliens ermöglichen.
Ein weiteres Forschungsfeld von Lercari ist es, bedeutende Museums-sammlungen zu digitalisieren. Diese will er im Internet so zugänglich machen, dass die Öffentlichkeit oder andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Daten arbeiten können. Zudem, so der Forscher, soll es auch darum gehen, die Sammlungen mit den Datenbanken anderer Institutionen zu verknüpfen.
So arbeitet Lercari zum Beispiel mit dem Bornholms Museum in Dänemark zusammen, um dessen umfangreiche Sammlung archäologischer und historischer Artefakte mittels 3D-Digitalisierung auf einer digitalen Plattform verfügbar zu machen. Darüber hinaus hat Lercari Digitalisierungsprojekte in München geplant – etwa mit dem Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke und der Staatlichen Antikensammlung.
Das alles soll helfen, den schleichenden Verlust von Wissen über die antike Welt aufzuhalten und die Primärdaten und Daten zum kulturellen Erbe nicht nur zu bewahren, sondern sie auch zu veröffentlichen. Zu diesen Daten gehören unter anderem etwa Feldzeichnungen, interpretative Notizen, Fotos und Illustrationen, aber auch Geo- sowie Metadaten, die im digitalen Zeitalter erheblich zugenommen haben.
Deshalb sucht Lercari auch nach automatisierten Methoden, damit die riesige Menge an 3D- und Geodaten, die Archäologen und Spezialisten zur Erforschung des kulturellen Erbes heute zur Verfügung stehen, systematisch analysiert werden kann. „Die hohe Präzision, mit der LiDAR Kulturerbestätten und historische Gebäude dokumentiert, in Kombination mit den analytischen Fähigkeiten des maschinellen Lernens bietet Forschenden neue und intelligente Methoden, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die dem bloßen Auge entweder verborgen bleiben oder aufgrund des großen Umfangs an Fallstudien Jahrzehnte in Anspruch nehmen würden.“
Entwicklung von KI-basierten Lösungen
Lercaris Team baut derzeit Kooperationen auf, um KI-basierte Lösungen für die automatische Klassifizierung und semantische Segmentierung von Kulturerbe-Daten zu entwickeln. So soll das Forschungspotenzial von KI und digitaler Forschung für Anwendungen im Bereich des Kulturerbes und ihre Nutzung durch Archäologen, Kunsthistoriker und Architekten erweitert werden.
Mit dieser transformativen Forschung an der LMU will Lercari die Digital Cultural Heritage Studies zu einer führenden Disziplin in Europa machen, die neue Technologien zur Erforschung, Digitalisierung, Analyse und zum Schutz der antiken Welt erforscht und sie auch im Kontext der geisteswissenschaftlichen Forschung verortet.

Kulturelle Vielfalt im China der frühen Neuzeit
Professor Max Oidtmann ist seit Januar 2022 Lehrstuhlinhaber am Institut für Sinologie der LMU. Sein Thema ist die Quing-Dynastie, eine Epoche, die wie ein Gegenbild zum heutigen China anmutet.
mit denen das heutige Europa konfrontiert ist, irrelevant erscheinen, doch der Sinologe Max Oidtmann argumentiert, dass jene durchaus eine Rolle spielen kann. „Die plötzliche und unerwartete Niederlage der jahrhundertealten chinesischen Qing-Dynastie in den 1840er-Jahren erinnert uns daran, welche Vorteile diejenigen haben, die sich schnell neue Energieformen aneignen und denjenigen überlegen sind, die das nicht tun. In einem kürzlich geführten Gespräch, das Verbindungen zwischen dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise in Europa und China herstellte, habe ich auf die revolutionäre Bedeutung der Kohlekraft vor fast 200 Jahren hingewiesen.“
Im Opiumkrieg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vernichteten die Briten die chinesischen Dschunken mit ihren viel schnelleren und wendigeren, weil mit Kohle angetriebenen Kriegsschiffen. „Die hatten zwar nur die Maschinenleistung, die der eines Honda Civic von heute entspricht“, so Oidtmann. Aber es hat für die Engländer gereicht, den Krieg schließlich für sich zu entscheiden, ihre Dominanz in China zu etablieren und das Land durch ungebremsten Opiumhandel zu destabilisieren“, sagt Oidtmann
Auch die Ukraine-Krise spielt sich fast ausschließlich im Rahmen dieses auf fossilen Brennstoffen basierenden Energiesystems aus dem 19. Jahrhundert ab. „Der einzige Ausweg für Europa ist letztlich der Übergang zu einem alternativen Energiesystem, das auf einer Kombination aus Atom- und Solarenergie beruht. Und auch daran arbeitet China derzeit.“
Die Quing-Dynastie von der Zeit ihrer Entstehung im 16. bis zu ihrem Ende im 19. Jahrhundert ist der Forschungsgegenstand von Max Oidtmann, der bis zu seiner Berufung an die LMU am Campus der Washingtoner Georgetown Universität in Doha, Katar, geforscht hat.
In der Quing-Epoche erreichte China durch Expansion unter anderem in die zentralasiatischen Steppengebiete, nach Tibet oder in die Mongolei seine größte geographische Ausdehnung.
„Mich interessiert, wie es diesem Riesenreich gelungen ist, die neu vereinnahmten Gebiete mit ihrer Vielzahl an unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Religionen über einen so großen Zeitraum erfolgreich zu regieren“, umreißt Oidtmann sein Spezialgebiet. Dabei interessieren den Sinologen nicht nur administrative, sondern auch rechtliche, kulturelle und militärische Aspekte, die hierbei eine Rolle spielten.
Es gelang den Regierenden, die verschiedenen Gemeinschaften durch Koalitionen in das Staatsgefüge einzubinden. Der Staat versuchte zwar, indigene Traditionen zu regulieren und zu modifizieren, und unterdrückte mitunter gewaltsam Gruppen, die er als bedrohlich empfand, aber häufiger versuchte er, verschiedene und zuvor fremde Kulturen zu fördern oder zu integrieren. „Lokale Konflikte konnten die Quing-Herrscher sogar nutzen, indem sie sich etwa mit ihnen genehmen Parteien zusammentaten und so Unterstützer fanden und Koalitionen stärken konnten.“
Ein Bewusstsein für Diversität, so Oidtmann, kennzeichne die Quing-Epoche in bedeutendem Maße. „Minoritäten wurden nicht als solche behandelt. Sie sahen sich selbst auch nicht so, sondern betrachteten sich als rechtmäßige Bewohner ihrer jeweiligen Regionen. Die Quing-Herrscher strebten keine homogene, jedoch eine loyale
Gesellschaft an“, erläutert der Sinologe.
Schwierige Forschungsbedingungen
Wichtig für seine Forschung ist auch immer die Gegenwart, die ohne historische Rückschau nicht zu verstehen sei.
Im heutigen China sieht Oidtmann massive Unterschiede insbesondere zur Epoche der Quing-Dynastie. „In der kommunistischen Partei Chinas gibt es einen Konsens darüber, dass Diversität gefährlich ist. Vor allem ethnische Minoritäten sind ihr ein Dorn im Auge – wie man an der Behandlung etwa der Uiguren sehen kann.“ Ebenso strebe man eine weitgehende Vereinheitlichung der Gesellschaft in kultureller Hinsicht an, in der sowohl bestimmte Dialekte oder differierende Traditionen möglichst vermieden werden sollen.
„Das Problem bei der jetzigen Regierung unter Xi Jinping ist, dass sie ein besonderes historisches Narrativ bemüht, um ihre Politik zu legitimieren. Dieses verbindet einige durchaus rechtmäßige Klagen über die Behandlung Chinas in der Vergangenheit zu einer Geschichte darüber, warum die Kommunistische Partei und das chinesische Volk eine einzigartige und besondere Rolle in der Welt spielen müssen. Das ist ein gefährliches Narrativ, ähnlich dem, wie es die russische Regierung hat, um den Einmarsch in der Ukraine zu legitimieren.“
Auch vor diesem Hintergrund findet Max Oidtmann die Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart Chinas enorm wichtig. „In den USA, in Kanada oder in Europa gibt es tatsächlich wenig Wissen über die unterschiedlichen Kulturen in China. Die Vorstellung, die wir haben, ist die eines konstanten und in punkto Kultur und Politik sehr uniformen Staatswesens.“
Er selbst konnte nicht nur als Student, sondern in den frühen 2000er-Jahren auch als Mitarbeiter einer Firma aus Hongkong viel Erfahrung über die Lebensbedingungen im Westen Chinas sammeln. „Das Unternehmen, bei dem ich tätig war, hatte die Aufgabe, gleichsam als Mittler Geschäftsleute und lokale Administrationen und Entscheidungsträger zusammenzubringen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Region auf ostchinesisches Niveau voranzutreiben.“
Faktisch ein geschlossenes Land
Die kulturelle Vielgestaltigkeit und Komplexität im Westen des Landes faszinieren ihn bis heute und waren der Grund, sich damit schließlich auch wissenschaftlich intensiv zu befassen.
In den vergangenen Jahren konstatiert der Historiker allerdings einen dramatischen Wandel in der chinesischen Politik, der es auch Forschenden vor allem aus dem Ausland erschwert, ihre Arbeit ungehindert fortzusetzen.
„Als ich 2007 begann, in dem Bereich zu arbeiten, gab es nicht viele Hindernisse. Es war nicht sehr schwer, gemeinsame Kollaborationen mit Forschenden in China durchzuführen. In den letzten fünf, sechs Jahren wurde es allerdings sehr viel mühevoller. Zuletzt setzte nicht nur das Regime ideologisch begründete Limits, sondern vor allem die Corona-Pandemie.“
Mittlerweile, sagt Oidtmann, würden nur noch wenige westliche Wissenschaftler Eingang in China finden. „Es ist faktisch ein geschlossenes Land.“
Die chinesischen Politiker, glaubt der Sinologe, gingen davon aus, dass der Kontakt mit dem Westen eine verlorene Sache sei und dass sie dort nicht die Verbündeten finden, die sie zu finden hofften. Andererseits sei das chinesische Modell auch immer weniger attraktiv für europäische Staaten. Das Interesse bei chinesischen Regierungs-vertretern, Brücken zu bauen und Studierende aufzunehmen, sei kaum mehr gegeben.
Die Forschungsbedingungen an der LMU sieht er dagegen sehr positiv und freut sich über „die fantastische Ausstattung“, die ihm von der Universität zur Verfügung gestellt wurde. „Eigentlich wollte ich mich für ein Alexander von Humboldt-Fellowship bewerben, aber nach meinem Besuch an der LMU, wo ich meine Forschung vorgestellt hatte, wurde ich gefragt, ob ich mich nicht für eine Professur interessiere“, so Oidtmann. Dass es geklappt hat, freut ihn sehr, zumal er die deutsche Universitätslandschaft im Vergleich etwa zum Vereinigten Königreich oder den USA auf einem guten Weg sieht. „Die Unis in Deutschland können ihr internationales Profil sehr schärfen, zudem gibt es gute und im Vergleich zu den USA gerechtere Zugangs- und Studienmöglichkeiten, aber vor allem auch gute Jobs. In Großbritannien hat der Brexit sehr dazu beigetragen, die Attraktivität der Unis zu mindern, und in den Vereinigten Staaten ist das System fragil und nicht mehr so attraktiv, wie es mal war – wenn man von Unis wie Harvard oder Yale mal absieht.“
Derzeit lernt Max Oidtmann Deutsch. Seine Kinder können es bereits, denn mangels Plätzen an der amerikanischen Schule in Doha, sind sie dort die deutsche internationale Schule gegangen.











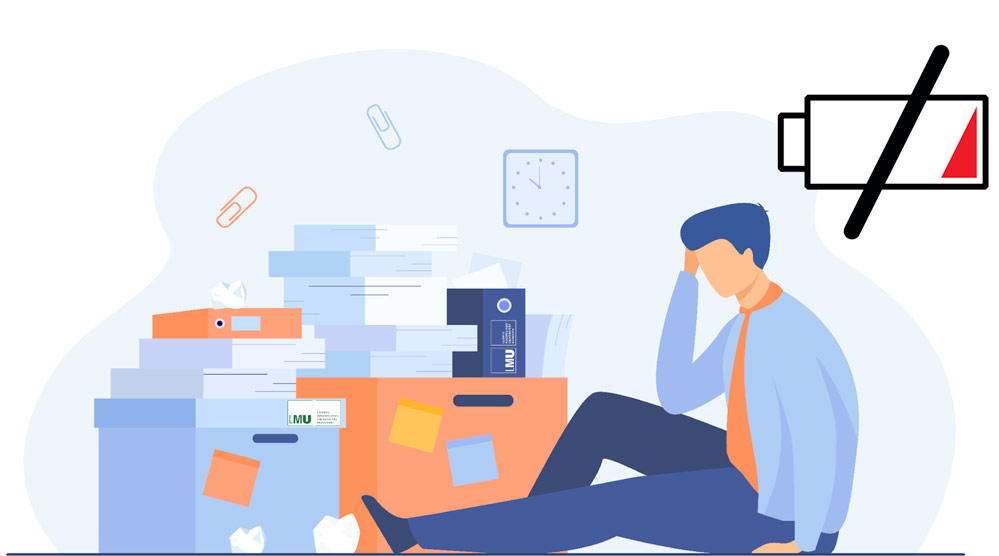







0 Kommentare