Feldforschung in Ecuador: Ein Wissenschaftler der Pluriversidad Amawtay Wasi (kniend) befragt zwei Bewohner seines Nachbardorfs. Sein Sohn begleitet ihn und dokumentiert das Gespräch mit Kamera und Aufnahmegerät. Foto: Anna Meiser
Am Ende der Vorlesungszeit steht ein Erntefest. Lehrende und Studierende feiern das während des Semesters gewonnene Wissen. An der Pluriversidad Amawtay Wasi (Kichwa: „Haus der Weisheit“) in Ecuador sieht man Lernen und Lehre ebenso wie den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn als einen Prozess, der sich mit der landwirtschaftlichen Produktion vergleichen lässt: Man sät – auf einem möglichst fruchtbaren und gut vorbereiteten Grund –, hegt und pflegt die jungen Keime, nutzt mit Sorgfalt die bestmöglichen Methoden, um reiches Wachstum zu generieren und eine hoffentlich reiche Ernte einzufahren. Die Früchte schließlich, also das erarbeitete Wissen und die neu gewonnenen Einsichten, werden gefeiert und geteilt: Sie sollen nähren, die Menschen stärken und neues, vielversprechendes Saatgut hervorbringen.
Das Bild des Ackerbaus hat starke Symbolkraft. Es rückt das akademische Arbeiten in einen Kontext, der in der Lebenswelt der indigenen Bevölkerung in Ecuador seit Jahrtausenden eine Rolle spielt. Die Pluriversidad Amawtay Wasi, gegründet 2004, ist eine besondere Bildungseinrichtung. Als interkulturelle Universität soll sie die Brücke schlagen zwischen akademischer Forschung, wie wir sie auch in Europa kennen, und dem Wissen, der Denkweise, aber auch der Sprache der indigenen Bevölkerung in Ecuador. Und gerade dadurch kann sie, ebenso wie andere interkulturelle Universitäten Lateinamerikas, der traditionellen vom europäischen Weltbild geprägten Akademia wichtige Anregungen geben.
„Wissen und Weisheit entstehen dort in einem gemeinschaftlichen Prozess.“
Anna Meiser ist im Rahmen ihrer Forschungsarbeit in die Welt der Pluriversidad Amawtay Wasi eingetaucht ebenso wie in die weiterer interkultureller Universitäten, etwa der Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) in Mexiko. Meiser ist seit Oktober 2021 Professorin für Interkulturelle Kommunikation an der LMU. Und als Ethnologin weiß sie, wie entscheidend der Perspektivwechsel auf die Sicht- und Denkweise der indigenen Bevölkerung in ihrem Fach für eine qualitativ- interpretative Forschung ist. „Wenn wir als Ethnologen in ein anderes Land reisen und dort fremde Kulturen erforschen, tun wir das immer vor dem Hintergrund unserer eigenen Kultur“, sagt sie. „Dabei fallen uns vor allem Dinge auf, die wir kennen und Dinge, die uns besonders fremd sind.“
Aus der Perspektive beider Kulturen betrachtet
Meiser, die im Nebenfach Politik und katholische Theologie studiert hat, nennt ein Beispiel: „Wenn ich in einem südamerikanischen Dorf eine Kirche betrete, erkenne ich vieles wieder, aber dann steht da vielleicht ein ausgehöhlter Baum mit einem Schlägel. Damit kann ich zunächst nichts anfangen.“ Erst durch die Forschung vor Ort erfahre ich, dass es sich um eine Trommel handelt, mithilfe derer in dieser Kultur zu politischen, aber auch religiösen Ereignissen zusammengerufen wird – also ein Art Glocke. Diese Eindrücke seien es, die dann das Bild prägten. Andere, die für die indigene Bevölkerung selbst vielleicht viel entscheidender sind, fallen zunächst weniger oder gar nicht ins Auge. Um ein Zeichen in seiner Bedeutung für eine bestimmte Kultur lesen zu können, braucht es den interkulturellen Perspektivwechsel: die Fähigkeit, ein Symbol mit den Augen der kulturell Anderen zu lesen.
Deshalb hatte sich Meiser entschlossen, nach der Kontaktaufnahme mit der Pluriversidad Amawtay Wasi zunächst nicht selbst nach Ecuador zu reisen. Stattdessen lud sie deren Rektor, Luis Fernando Sarango Macas, zu einem Forschungsaufenthalt an die Universität Freiburg ein, wo sie selbst bis zum Herbst 2021 tätig war. Meiser wollte wissen, wie sich der akademische Betrieb im Breisgau in den Augen des ecuadorianischen Wissenschaftlers ausnehmen würde.
Zu den markantesten Auffälligkeiten zählte für Macas die streng hierarchische Struktur der Lehre. Es gibt die Lehrenden, die über das Wissen verfügen, und Studierenden, die von den Dozierenden lernen. Dass der Lernprozess wechselseitig sein kann, sei ein eher unüblicher Gedanke. Im Gegensatz gilt – gemäß der Tradition der indigenen Bevölkerung – an der Pluriversidad Amawtay Wasi der Grundsatz, dass Wissen und Weisheit in einem gemeinschaftlichen Prozess entstehen: Lehrende und Studierende lernen voneinander.
Darüber hinaus unterscheiden sich Ausrichtung von Wissenschaft und Forschung an beiden Institutionen grundsätzlich, wie Meiser nach ihren Besuchen in Ecuador, Bolivien und Mexiko bestätigen kann. „In Europa geschieht Forschung häufig um der Forschung willen, also um Wissen zu generieren, ohne dass dieses zwingend einen offensichtlich erkennbaren Nutzen erfüllen muss“, sagt sie. An den interkulturellen Universitäten Lateinamerikas sei Forschung deutlich zweckorientierter. Im Zentrum stehen Projekte, die die Region und die indigene Bevölkerung stärken sollen. Das macht die Menschen handlungsfähig, wenn etwa ein Straßenbauprojekt geplant ist, das Infrastruktur, landwirtschaftliche Nutzflächen oder traditionell bedeutsame Orte der indigenen Bevölkerung stört.
„Ein weiteres wichtiges Anliegen dieser Universitäten ist die ‚Dekolonialisierung‘ von Forschung und Wissenschaft“, so Meiser. Gemeint ist damit einerseits die Kritik daran, dass akademische Forschung und Lehre an Universitäten weltweit auf einer europäischen Denkweise und Praxis beruhen. Traditionelle Wege nicht-westlicher Bevölkerungsgruppen, um Wissen zu generieren und weiterzugegeben, werden in der Regel nicht berücksichtigt. Die Form von Forschung und Lehre sind demnach in nicht-westlichen Ländern letztlich ein Erbe der Kolonialisierung; politische und wirtschaftliche Zentren sind auch Zentren der Wissensproduktion. Nicht zuletzt deshalb soll das Erntefest an der Pluriversidad Amawtay Wasi auch ein Symbol dafür sein, den Prozess von Forschung und Lehre stärker in die eigene Tradition einzubetten.
Wie die indigene Bevölkerung stärker von Forschung profitiert
Mehr noch: Wenn Forschende in ferne Länder reisen, etwa für ethnologische aber auch für naturwissenschaftliche Feldforschung, dringen sie dabei als Beobachter in indigene Kulturen und Lebensräume ein. Und sie nehmen Wissen mit, das sie aus ihrer eigenen Perspektive interpretieren und mit dem sie ihre eigene wissenschaftliche Karriere voranbringen. Die indigene Bevölkerung profitiert in der Regel nicht, und auch an der Interpretation und dem wissenschaftlichen Ansehen der Arbeit ist sie nicht beteiligt.
„Auch das lässt sich als eine Form der Kolonialisierung und Ausbeutung sehen“, so Meiser. Die neuseeländische Professorin für indigene Bildung, Linda Tuhiwai Smith, selbst Maori, benannte „Forschung“ in diesem Zusammenhang als das schmutzigste Wort im Vokabular der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Für die interkulturellen Universitäten ist es daher entscheidend, an den Forschungsprojekten wirklich beteiligt zu sein. Nicht nur als Protagonisten und Forschungsobjekte, sondern aktiv als wissenschaftliche Partner.
Anna Meiser hat deshalb in Zusammenarbeit mit ihren lateinamerikanischen Kollegen Projekte initiiert, in denen Studenten beider Länder gemeinsam einer Fragestellung nachgehen – und so die Perspektiven beider Kulturen und die daraus resultierende Interpretation in die Forschungsarbeit einbringen. Das stärkt letztlich nicht nur die Position der indigenen Bevölkerungsgruppen im Forschungsprozess. Die gemeinsam eingeholte Ernte verspricht auch neue Interpretationsmöglichkeiten gespeist aus authentischem Wissen und damit eine neue Dimension interkultureller Forschung.
Stefanie Reinberger
Prof. Dr. Anna Meiser
ist Professorin für Interkulturelle Kommunikation und Leiterin des gleichnamigen Instituts an der LMU.


















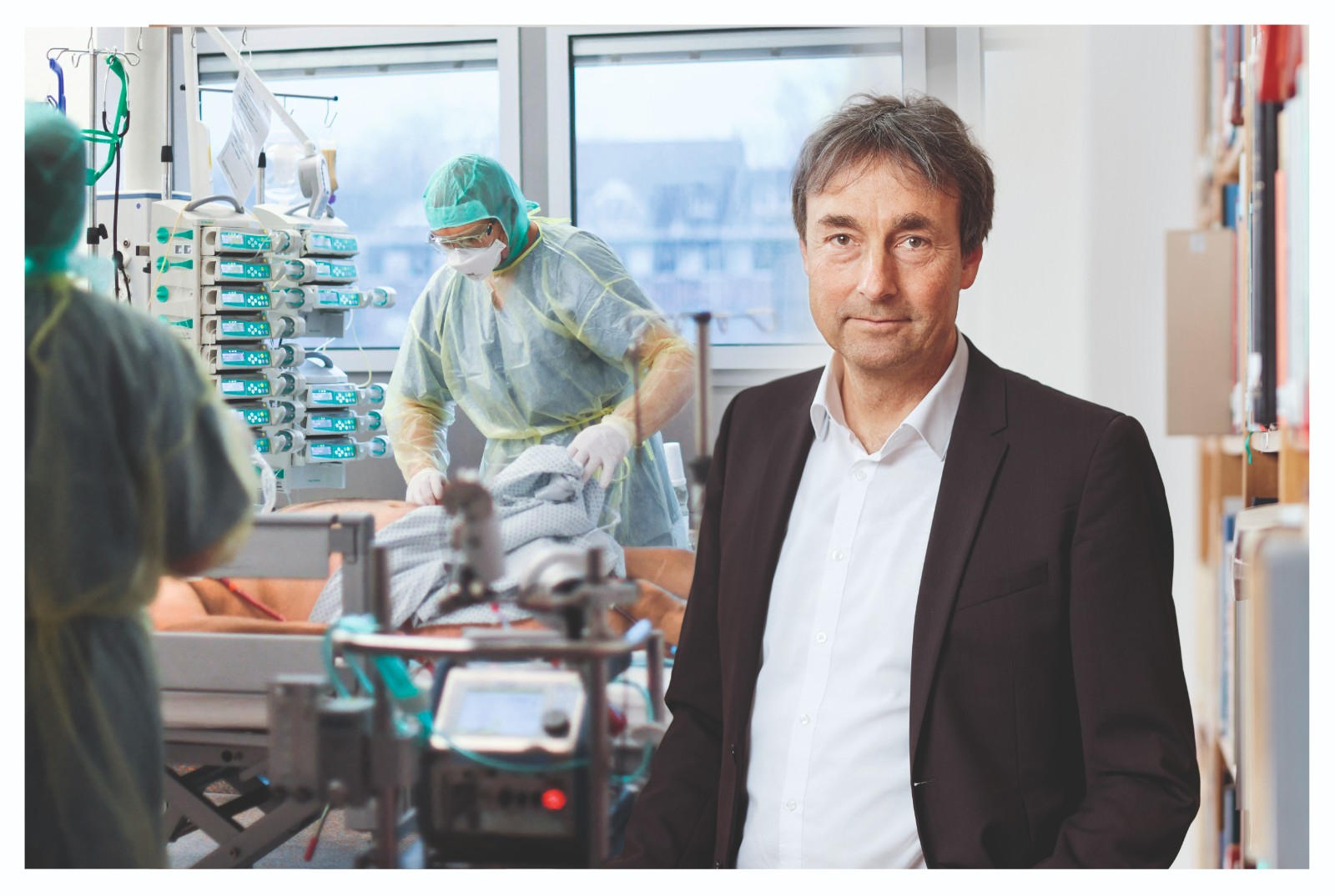

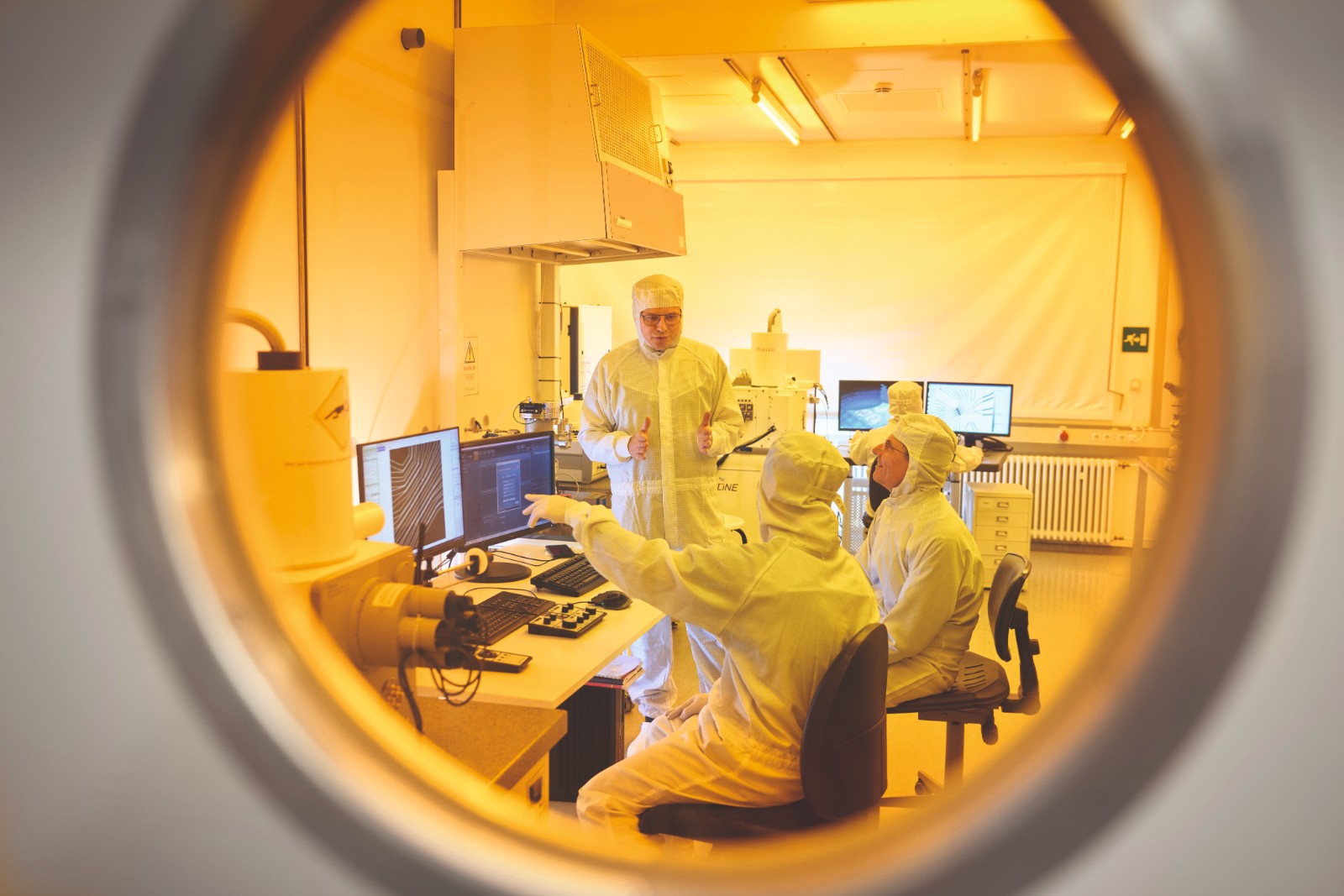



0 Kommentare