„Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd“, schrieb die Autorin Christa Wolf (1926-2011) in ihrem 1976 erschienenen autobiographisch gefärbten Werk „Kindheitsmuster“. Was sie beschreibt, ist die massive Verletzung der Psyche durch furchtbare, überwältigende Ereignisse im Krieg und auf der Flucht – und wie diese einen Menschen ein Leben begleiten und beeinflussen und noch die nächsten Generationen beeinträchtigen können. Etwas Schweres lastet auf der Familie und drückt noch auf Kinder und Kindeskinder. Und das obwohl die jüngeren Generationen eigentlich gar nichts wissen können von dem Schrecklichen, das ihren Eltern oder Großeltern widerfahren ist, weil über die Ereignisse nicht gesprochen wird. Oder vielmehr: Sie leiden gerade deshalb.
Aus heutiger Sicht ist es recht deutlich, was die Autorin beschreibt: das Phänomen des transgenerationalen Traumas. Gemeint ist die Weitergabe einer nicht verarbeiteten traumatischen Erfahrung an nachfolgende Generationen. Wie es dazu kommt und wie sich diese Weitergabe unterbrechen lässt, untersuchen Forschende der LMU.
Betroffene mit transgenerationalem Trauma können unter einer unerklärlichen Traurigkeit bis hin zu Depressionen, unter diffusen Ängsten, Panikattacken und Schlaflosigkeit oder körperlichen Symptomen leiden. Sie quälen sich mit grundlosen Schuldgefühlen, Scham, Unsicherheit oder einem permanenten Gefühl von Verlorenheit. Kurz: Sie haben Symptome einer Traumafolgestörung – ohne selbst das eigentliche traumatisierende Ereignis durchlebt zu haben. Sie haben das Trauma quasi „geerbt“.
Wenn Betroffene über das Geschehene nicht mehr reden können
Wer verstehen will, wie es dazu kommt, muss sich zunächst vor Augen führen, wie eine Traumatisierung überhaupt entsteht und was sie für die Betroffenen bedeuten kann. Ein Experte für diese Frage ist Professor Thomas Ehring, Lehrstuhlinhaber für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der LMU sowie Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz und Traumaambulanz. „Unter einem Trauma verstehen wir in der Psychologie ein extremes Ereignis, das mit Bedrohung durch Tod beziehungsweise Verletzung oder sexueller Gewalt einhergeht“, sagt Ehring. Solche Ereignisse sind etwa Krieg und damit verbundene Gräueltaten, Naturkatastrophen, schwere Unfälle, Amokläufe, Missbrauch, aber auch plötzlicher Kindstod oder das Auffinden eines Angehörigen nach Suizid. Oft ist dabei das eigene Leben massiv bedroht – oder man muss als Zeuge hilflos mit ansehen, wie das Leben anderer ausgelöscht wird. Und auch Helfer in Krisensituationen können diese als traumatisierend erleben.
Doch nicht alle Menschen, die eine derart belastende Situation durchleben, tragen langfristige Schäden davon. In der weltweit größten Studie zur Traumafolgestörungen gaben 60 Prozent der befragten US-Bürger an, zumindest ein traumatisierendes Ereignis erlebt zu haben. Dagegen litten aber nur acht Prozent der Männer und zwanzig Prozent der Frauen an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). „Bei massiver Gewalt und insbesondere sexuellem Trauma sind die Betroffenenzahlen allerdings höher“, ergänzt Ehring.
Studien deuten darauf hin, dass es bestimmte genetische Risikofaktoren gibt, die sich etwa auf das Hormonsystem auswirken und anfälliger machen für anhaltenden Stress. „Ganz entscheidend sind aber auch soziale Faktoren“, sagt Ehring. „Wie geht es für die Betroffenen nach einem durchlebten Trauma weiter? Sind sie sozial gut eingebunden, ist das in guter Schutzfaktor. Werden sie dagegen alleingelassen oder sind immer wieder neuen Stressoren ausgesetzt, steigt das Risiko für Traumafolgestörungen.“ Ein großes Problem sei auch Vermeidungsverhalten – wenn Betroffene vor lauter Angst, an das schlimme Ereignis erinnert zu werden, bestimmte Orte meiden, oder über manche Themen nicht mehr sprechen können. Auch dann steigt das Risiko für langfristige Folgen.
Genau das mache das Thema für ihn so faszinierend, verrät Ehring. „Es sind viele Faktoren, auch externe wie das soziale Umfeld und die Gesellschaft, die über die Reaktion auf Traumata und Traumafolgestörungen entscheiden. Daher haben wir auch viele Angriffspunkte für die Intervention.“ Das betreffe die akute Krisenintervention sowie die Begleitung nach einem traumatisierenden Ereignis, die dazu beitragen können, dass es gar nicht erst zu Folgestörungen kommt. „Aber auch für eine bereits manifestierte PTBS kennen wir gut untersuchte und effektive Therapiemethoden,“ so Ehring.
„Bei manchen Kindern von Eltern mit Traumafolgestörungen beobachten wir schon sehr früh Auffälligkeiten im Verhalten. Bereits bei Einjährigen können wir sehen, dass sie unter Stress stehen.“
Professorin Corinna Reck
Allerdings: Dazu müssen traumatisierte Menschen erst einmal erkennen, dass sie Hilfe brauchen und diese auch suchen. „Das Problem ist, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Und diese Menschen bekommen häufig keine Hilfe – oder erst dann, wenn sich ihre Symptomatik bereits chronifiziert hat und schwer zu behandeln ist.“
Die Geister, die aus der Vergangenheit ins Kinderzimmer drängen
Genau hier – in den verdrängten und unbehandelten Traumata – besteht die Gefahr der Weitergabe an die nächste Generation. Professorin Corinna Reck ist Leiterin der Lehr- und Forschungseinheit Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters und Beratungspsychologie an der LMU sowie der Hochschulambulanz für Babys, Kleinkinder, Jugendliche und (werdende) Eltern. Sie untersucht, wie sich psychische Erkrankungen von Eltern auf die psychische Gesundheit der Kinder auswirken. „Verschiedene Mechanismen sind bei der Weitergabe von psychischen Erkrankungen an die nächste Generation wirksam, sowohl biologische als auch psychogische“, sagt Reck. „Gerade im Zusammenhang mit Traumafolgestörungen und PTBS gibt es zahlreiche Studien, die darauf hindeuten, dass epigenetische Veränderungen eine Rolle spielen.“ Dabei handelt es sich um chemische Modifizierungen am Erbgut, die regulieren, ob und in welchem Maße ein bestimmtes Gen abgelesen wird oder nicht. Diese Veränderungen wirken sich dann beispielsweise darauf aus, wie der Körper auf Stresshormone reagiert. „Uns interessiert die psychologische Sicht, also wie sich das Verhalten Betroffener auf die Nachkommen auswirkt, weil wir darauf gut Einfluss nehmen können“, sagt Reck. Sie ist überzeugt, dass für die transgenerationale Weitergabe von traumatischen Erfahrungen die ersten Lebensmonate besonders wichtig sind.
Grund dafür ist das Verhalten der traumatisierten Eltern, das sich auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Die Psychoanalytikerin Selma Fraiberg (1918-1981) sprach von „Ghosts in the Nursery“, also von Geistern, die aus der Vergangenheit ins Kinderzimmer drängen. Das kann – im Extremfall – ein traumatisierter Vater sein, der von seinem eigenen Vater misshandelt wurde, und dieses Verhalten nun weitergibt und seine eigenen Kinder schlägt.
Die Schwierigkeit, die eigenen Emotionen zu spüren und zu vermitteln
Oft aber wirken die Geister, mit denen sich die Eltern herumquälen, sehr viel subtiler, wenn zum Beispiel ein traumatisierter Elternteil innerlich oder tatsächlich auf Distanz geht, um das Kind zu schützen. Babys sind jedoch auf den Kontakt mit ihren Bezugspersonen angewiesen. Und sie reagieren sensibel, wenn sie diesen nicht herstellen können – etwa, weil Eltern aufgrund ihrer eigenen Belastung emotional nicht erreichbar sind.
Das zeigt sich in einem Experiment, das Forschende aus den USA bereits in den 1970er-Jahren durchgeführt haben: Babys suchen den Kontakt über das bewegte Mienenspiel von Mutter und Vater. Frieren diese ihre Gesichtszüge nun für ein paar Minuten ein, sind gesunde Säuglinge und Kleinkinder irritiert. Sie beginnen zu protestieren, bis sich der Kontakt wieder herstellen lässt – oder sie lassen ihren Blick von der unerreichbaren Person abschweifen, wenn dies nicht gelingt. Diese eingefrorene Mimik findet sich auch häufig bei Menschen mit Traumafolgestörungen; ihre Babys erfahren die verminderte Kontaktqualität dann quasi als Normalzustand.
Dazu kommt: Menschen mit Traumafolgestörungen können häufig ihre eigenen Emotionen nur schwer spüren und zum Ausdruck bringen. Aber auch die Emotionen anderer zu lesen fällt ihnen schwer und setzt sie unter Stress. Das wirkt sich auf die Interaktion mit den eigenen Kindern aus – vom ersten Tag an, weil Eltern dann auf die kindlichen Bedürfnisse nicht angemessen eingehen können. Sie können zum Beispiel impulsiv oder sogar ablehnend und feindselig reagieren, weil sie das Schreien des Babys als Angriff gegen ihre eigene Person interpretieren. Oder weil die körperliche Nähe, die der Säugling fordert, bedrohlich wirkt auf das traumatisierte Elternteil. Es kommt immer wieder zu vorübergehenden Unterbrechungen im Kontakt. In der Folge kann die Fähigkeit, gesunde zwischenmenschliche Bindungen einzugehen, beim Baby von Anfang an beeinträchtigt sein.

„Bei manchen Kindern beobachten wir schon früh Auffälligkeiten im Verhalten“, sagt Reck. „Bereits bei Einjährigen können wir sehen, dass sie unter Stress stehen.“ Die Kinder sind hypersensibel für die Stimmung ihrer Bezugspersonen und können dann nicht so unbelastet und spielerisch die Umgebung explorieren wie ihre Altersgenossen.
Doch wie lässt sich diese Spirale durchbrechen? Corinna Reck arbeitet mit ihrem Team in der Hochschulambulanz mit betroffenen Eltern und ihren Babys. Oft finden die jungen Familien zu ihr, weil bei der Mutter etwa eine postpartale Depression diagnostiziert wurde, also eine sogenannte Wochenbett-Depression. Oder weil sie sich total überfordert fühlen. „Meist funktioniert ein beeinträchtigtes Bindungsverhalten, wie es bei Menschen mit Traumafolgestörungen vorkommen kann, in der Paarbeziehung noch“, sagt Reck. Das liege häufig daran, dass sich Paare mit ähnlichem – oft vermeidendem – Bindungsstil finden. „Aber sobald ein Baby mit dem natürlichen Bedürfnis nach großer Nähe dazukommt, gerät das System ins Wanken.“
Um die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern, nutzt Reck einen integrativen Ansatz mit körpertherapeutischen Elementen. Dieser geht auf den US-amerikanischen Psychologen George Downing zurück. Diese Herangehensweise stützt sich darauf, dass Erfahrungen nicht nur als Worte oder innere Bilder im Gehirn, sondern auch durch Körpererinnerungen gespeichert werden. Bezieht die therapeutische Arbeit die Körperebene mit ein, lässt sich ein besserer Zugang zu den Problemen, aber auch zu den Ressourcen der Betroffenen finden.
Konkret lässt Reck beispielsweise eine Mutter, die körperlichen Kontakt als bedrohlich empfindet, ihr Kind auf den Arm nehmen. Wie fühlt sich das an? Die Mutter soll sich dann auch – zunächst ohne das Kind – in eine Situation hineinversetzen, in der sie sich wohl und entspannt fühlt. Auch hier gilt es nun, genau zu spüren, wo und wie sich diese Sicherheit im Körper bemerkbar macht. Sie versucht, dieses Gefühl im Körper zu imaginieren, und nimmt ihr Kind wieder auf den Arm. Dieses Vorgehen, so zeigt sich in Recks Arbeit, trägt dazu bei, dass die Mutter ihre eigene Anspannung besser wahrnehmen und regulieren kann, was ihr wiederum eine feinfühligere Interaktion mit dem Baby erlaubt.
„Ganz entscheidend sind soziale Faktoren. Wie geht es für die Betroffenen nach einem durchlebten Trauma weiter? Sind sie sozial gut eingebunden, ist das in guter Schutzfaktor.“
Professor Thomas Ehring
Der beste Schutz für die nächste Generation wäre jedoch, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Besonders unverarbeitete Traumata, können sich in Traumafolgestörungen manifestieren und ungefiltert an die nächste Generation weitergegeben werden. Der beste Schutz für die Nachkommen ist also, das Schweigen zu brechen und ein bestehendes Trauma zu behandeln. „Dabei kommen wir in der Therapie nicht um die Konfrontation mit der Erinnerung an das Trauma herum, auch wenn das unangenehm und anstrengend ist für die Betroffenen“, sagt Thomas Ehring. Der Grund: Eine Traumafolgestörung entsteht dann, wenn das Gehirn nicht in der Lage ist, das Erlebte zu verarbeiten. Um es zu integrieren, muss die Geschichte in der Erinnerung nochmals durchlebt werden und in den neuen Kontext – ich bin jetzt in Sicherheit – eingeordnet werden.
Ehring betreibt mit seinem Team Therapieforschung – um die zur Verfügung stehenden Methoden noch zu verbessern. Er interessiert sich unter anderem dafür, wie „Rescripting“, also ein bewusstes Überschreiben des Erlebten, bei der Verarbeitung unterstützen kann. „Dabei werden die Erinnerung in der Vorstellung wieder hervorgeholt. Statt diese – wie in der konfrontativen Therapie – dann aber einfach zu wiederholen, wird das Drehbuch geändert und die Betroffenen erleben in der Imagination, dass jemand zur Hilfe kommt, den Täter entmachtet, und das Kind schützt und versorgt“, so Ehring. In seinen Studien hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen hilfreich sein kann, um die gefühlte Selbstwirksamkeit der Betroffenen zu stärken, aber auch Scham abzubauen. „Was wir allerdings noch nicht wissen, ist, ob und inwiefern das Rescripting die Erinnerung an die Fakten dessen, was passiert ist, beeinträchtigen kann“, so Ehring. Das wäre dann wiederum ungünstig, wenn eine Gewalttat vor Gericht verhandelt werden soll. Ehring geht dieser Frage aktuell zusammen mit seinem Team nach.
Doch egal, ob vor Gericht, um ein Stück Gerechtigkeit herzustellen, oder für den eigenen Verarbeitungsprozess: Die Konfrontation mit dem Trauma ist unabdingbar, um es aufzulösen. Christa Wolf beschreibt das in ihrem Buch so: Sie lässt die Protagonistin an den Ort ihrer Kindheit zurückreisen. Hier werden Erinnerungen geweckt und so das Schweigen gebrochen – das selbst auferlegte und das von der Gesellschaft erwartete. Und genau damit vollzieht sie einen entscheidenden Schritt zur Heilung.
Stefanie Reinberger

Prof. Dr. Corinna Reck leitet die Lehr- und Forschungseinheit für Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters & Beratungspsychologie sowie die Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Babys, Kinder, Jugendliche und (werdende) Eltern an der LMU. Corinna Reck, Jahrgang 1964, studierte Psychologie an der Philipps-Universität Marburg und wurde an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg promoviert. Sie war Wissenschaftliche Mitarbeiterin, später Leitende Psychologin am Klinikum der Universität Heidelberg, wo sie sich auch habilitierte. 2013 wurde Corinna Reck an die LMU berufen. Außerdem machte sie eine Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin, am Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP) in Heidelberg, Approbation 2019, und absolvierte Weiterbildungen unter anderem in körperorientierter Psychotherapie und Video-Interventions-Therapie nach George Downing.

Prof. Dr. Thomas Ehring ist Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der LMU und Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz und Traumaambulanz. Ehring, Jahrgang 1973, studierte Psychologie an den Universitäten Mainz und Hamburg. Anschließend machte er seinen Ph.D. am King’s College London und arbeitete als Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bielefeld. Anschließend war er Assistant Professor an der Universiteit van Amsterdam, Niederlande, während er zwischenzeitlich die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten am IPP Münster mit der Approbation abschloss. Ehring war Professor für Klinische Psychologie an der Universität Münster, bevor er 2015 an die LMU kam.




















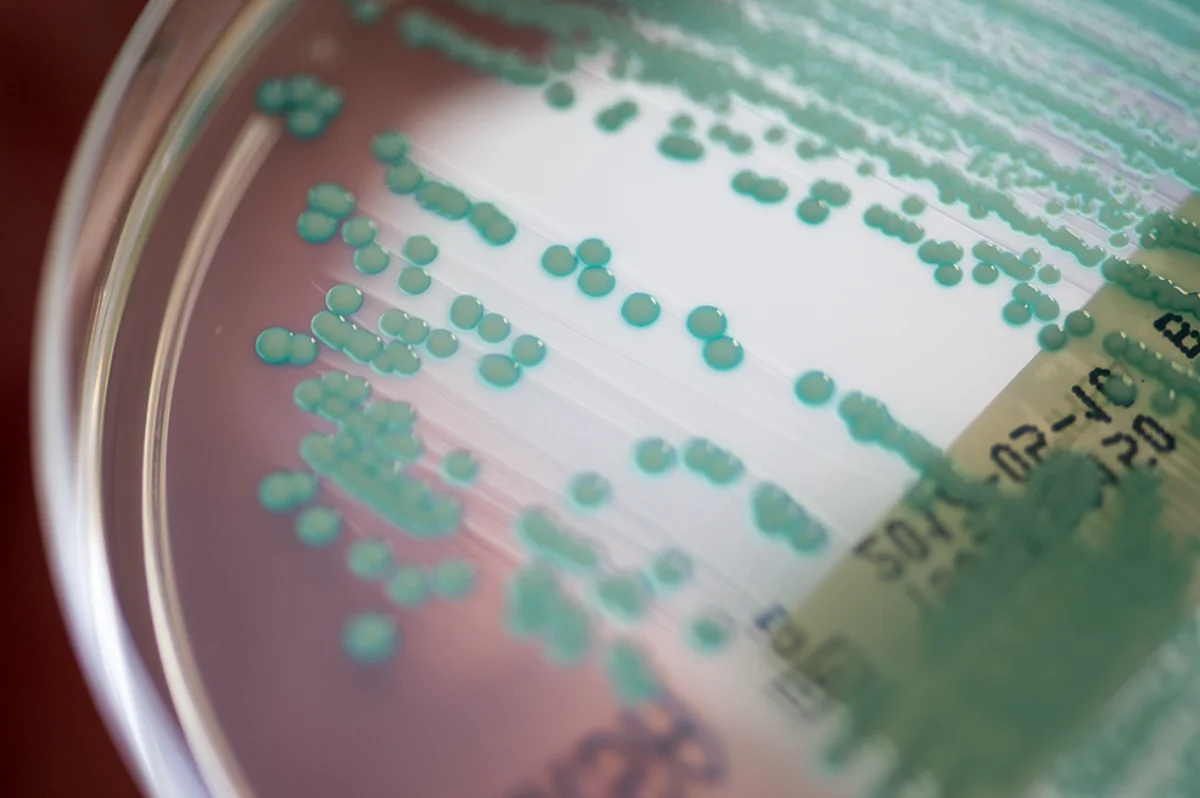
0 Kommentare