Reichtum kennt auch in Deutschland offenbar kaum Grenzen. Die zehn wohlhabendsten Deutschen bringen es zusammen auf ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar. Im internationalen Vergleich sind sie damit allerdings eher Mini-Musks. Der Tesla Chef, der mittlerweile im globalen Ranking Jeff Bezos von Amazon überholt hat, kommt allein auf 240 Milliarden. Ist dieses Wachstum ein globaler Trend und ist die Skala da nach oben offen?
Fabian Pfeffer: Wir haben einmal versucht, in einem Erklärvideo zu fassen, wie exorbitant die Vermögensungleichheiten sind. Würde man das Vermögen von Herrn Musk in Ein-Dollar-Münzen stapeln, reichte diese Säule von der Erde weit über den Mond hinaus – astronomisch im wahrsten Sinne des Wortes. Diese absoluten Extreme sind in Deutschland etwas weniger ausgeprägt, da geht der Stapel der Vermögendsten „nur“ bis zur Internationalen Raumstation. Aber die Zahl der Multimilliardäre und ihre Vermögen steigen. Doch auch abgesehen vom allerobersten Rand gibt es eine sehr starke Ungleichverteilung über das gesamte Spektrum hinweg. Ich nenne das die ,Vermögensungleichheit der unteren 99 Prozent‘.
Wie sieht die aus?
Pfeffer: Es heißt ja gerne, dass Deutschland dank seiner Anstrengungen, die Ungleichheit etwa dank unserer wohlfahrtsstaatlichen Investitionen im Zaum zu halten, im internationalen Vergleich noch relativ gut dastehen. Das gilt allerdings nur für die Verteilung der Einkommen. Auch dort ist die Ungleichheit in den letzten Jahren gewachsen, aber sie fällt geringer aus im internationalen Vergleich, da liegt Deutschland vielleicht im Mittelfeld. Aber bei den Vermögen sind wir nicht so weit hinter den USA. Wir messen Ungleichheit oft mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten, der geht von 0 bis 1 ist. 0 würde bedeuten, alle Haushalte hätten das genau gleiche Vermögen. Das andere Extrem: 1 hieße, einer besäße alles. Deutschland liegt hier bei ungefähr 0,80.
Wo ist der Wohlstand denn einigermaßen ausgeglichen?
Pfeffer: Wir schauen oft auf die skandinavischen Länder. Doch auch hier gilt: Die Einkommensverteilung ist vergleichsweise egalitär, aber die Vermögensungleichheit in Schweden oder Norwegen ist in etwa so hoch wie in Deutschland. Ein interessantes Beispiel ist die Slowakei, das konnten wir in einem internationalen Vergleich zeigen. Dort ist die Vermögensverteilung wesentlich gleichmäßiger.
Woher kommt das?
Pfeffer: Die Vermögensungleichheit hängt in den meisten Ländern im Wesentlichen davon ab, wie ungleich Hauseigentum verteilt ist. Dabei geht es nicht nur um die Eigentümerquote, darum also, wie viele Familien sich ein Haus leisten können, sondern auch um die Verteilung des Hausvermögens. Und da sticht die Slowakei heraus, da beim Zusammenbruch des Sozialismus das Wohneigentum neu verteilt wurde. Praktisch wurde fast jeder zum Wohneigentümer gemacht und konnte im Unterschied zur DDR dieses Wohneigentum auch halten.
Wer über Geld verfügt, kann Zugang zu Chancen erkaufen
Vermögen bringt Vorteile, die ja weit über die Möglichkeiten hinausgehen, sich einen hohen Lebensstandard zu leisten. Worin liegen denn die wahren Vorteile von Vermögen?
Pfeffer: Wir unterscheiden mehrere Funktionen von Vermögen. Eine davon ist die Kauffunktion. Wenn ich über Geld verfüge, das ich investieren kann, kann ich mir den Zugang zu Chancen erkaufen: Ich kann meine Kinder auf Privatschulen schicken, ich kann Nachhilfeunterricht bezahlen, ich kann meinen Kindern Aktivitäten ermöglichen, die Bildungswert für sie haben. Ich kann sie an teure Universitäten im Ausland schicken.
Aber die Vorteile von Vermögen bei der gesellschaftlichen Positionierung reichen ja noch weiter.
Pfeffer: Genau. Was mich in meiner Forschung besonders interessiert, ist die Versicherungsfunktion von Vermögen. Familiäres Vermögen schafft ein privates Sicherheitsnetz und wirkt in gewisser Weise ähnlich wie unsere öffentlichen Sicherungssysteme. Wenn es um Investitionen in die Zukunft geht, um die Gründung einer Firma etwa oder seien es auch Investitionen in den Bildungs- und Berufserfolg der Kinder. Oder die Frage was die Kinder studieren. Überall gibt es da Risiken, die durch elterliches Vermögen abgefedert werden. Allein schon das Wissen darum, dass sie sich im Notfall auf elterliches Vermögen verlassen könnten, ändert wahrscheinlich schon ihre Entscheidung. Diese Versicherungsfunktion ist fundamental.
Wie wirkt sie sich aus?
Pfeffer: Wir konnten zeigen, dass sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen elterlichem Vermögen und dem Erfolg der Kinder ergibt, nicht nur in den USA mit seinen dominierenden Privatschulen und -universitäten, sondern auch in Deutschland und gar in Schweden. Damit überträgt sich die Vermögensungleichheit auf die nächste Generation. Der Versicherungseffekt zeigt sich auch an anderer Stelle: Mit einem Kollegen vom Wissenschaftszentrum in Berlin können wir zeigen, dass Vermögen auch oft zur Überbrückung von Arbeitslosigkeit eingesetzt wird. In vielen Fällen hat dies auch eine intergenerationale Komponente: Manchmal ist es elterliches Geld, das diese Scarring Effects, die Narbeneffekte von Arbeitslosigkeit, abfängt und eine Einkommensdelle verhindert. Das zeigen zum Beispiel unsere laufenden Arbeiten aus Schweden.
„Wir lassen Wachstumsmöglichkeiten auf dem Tisch liegen, wenn bestimmte Chancen nur denen erwachsen, die ein privates Sicherheitsnetz haben.“
Man könnte ja auch noch weitere Bereiche des Lebens durchgehen, Gesundheit etwa oder kulturelles Kapital. Im Endeffekt ist es ja alles verbunden mit mehr Sicherheit und mehr Möglichkeiten. Kann man das so zusammenfassen?
Pfeffer: Absolut. Und da ist die deutsche Sprache sehr reich, weil ja das Wort Vermögen das auch schon beinhaltet. Es steht einerseits für das Kapital und andererseits für das Vermögen, etwas zu tun, also die Möglichkeiten, die es eröffnet.
Das heißt, es geht um weit mehr als um eine Neiddebatte, darum, dass da einer ist, der viel mehr hat als man selbst? Sondern um strukturelle Defizite, die mit unfairen Verteilungen zu tun haben?
Pfeffer: Ja, sicherlich, wobei ,unfair‘ natürlich eine normative Kategorie ist. Ich denke, es gibt gute Argumente dafür zu sagen, dass eine Gesellschaft, die Ungleichheit intergenerational vererbt, sowohl eine weniger gerechte Gesellschaft ist als auch eine ökonomisch weniger effiziente. Wir lassen Wachstumsmöglichkeiten auf dem Tisch liegen, wenn bestimmte Chancen nur denen erwachsen, die ein privates Sicherheitsnetz haben.
Das Verschmelzen von Machtpositionen
Vermögen eröffnet auch Möglichkeiten der politischen Einflussnahme …
Pfeffer: In den USA ist die Einflussnahme offensichtlich, schon mit dem Finanzierungssystem der Parteien. In Deutschland haben wir da noch andere Regeln, trotzdem gibt es natürlich auch hier Einflussnahme. Man kann sich beispielsweise fragen, wie die Ausnahmen, wie wir Betriebe vererben können und wie wir weiteres Kapital in Betriebe stecken können, damit es dann steuerfrei vererbt wird, in die Steuergesetze kommen und für wen die gemacht sind. Wohl nicht für die 95 Prozent der Familienunternehmen, die vielleicht die meisten Deutschen bei dem Begriff im Sinn haben, den kleinen Bauernhof oder den Handwerksbetrieb.
Es gibt weltweit zahlreiche Beispiele, dass sehr reiche Personen oder Unternehmen Medien- und Verlagshäuser kaufen, die teilweise nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören. Wie viel Macht bekommen diese Eigentümer damit?
Pfeffer: Ich denke da an den US-Soziologen Charles Wright Mills, der schon den 1950er-Jahren beschrieb und dafür sehr angefeindet wurde, wie sich die Eliten in Ökonomie, Politik und Militär zu einer Machtelite koordinieren. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr um Koordinierung, sondern um Personalunion geht. Wenn ein Großunternehmer eine einflussreiche Tageszeitung aufkauft und dann die traditionelle Wahlempfehlung des Blattes zur US-Wahl verhindert, dann bedeutet das ein Verschmelzen von Machtpositionen.
Fragwürdig?
Pfeffer: Ich stelle mir vor, wie in 250 Jahren die Geschichtsbücher geschrieben werden. Da steht dann beispielsweise drin, dass ein Tech-Milliardär die Entscheidungshoheit darüber hatte, ob Satelliten in einem Kriegsgebiet an- oder ausgestellt werden. Das wird im Rückblick wahrscheinlich nur dystopisch zu nennen sein. Vielleicht wird man mit großer Verwunderung auf unser Jetzt schauen, dass solche extremen Vermögensungleichheiten sich durchgesetzt haben und Machtkonzentrationen akzeptiert wurden.

Eine Gefahr also für die Demokratie? Droht ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft?
Pfeffer: Die Gefahr sehe ich. Ich muss jetzt allerdings auch eine klassische Wissenschaftlerantwort geben: Das bedarf noch weiterer Forschung. Wir untersuchen, ob Vermögensungleichheit und das Zurückbleiben von ganzen Bevölkerungsgruppen hinter dem sich absondernden obersten Teil, ob genau diese Entwicklung den sozialen Zusammenhalt gefährdet. Vor Kurzem bin ich mit einem Fernsehredakteur nach Hof gefahren, Schwabinger Professor trifft arme Gemeinde, so in etwa. Er ist mit mir durch die Stadt gegangen, wir haben mit Leuten geredet, die sich in Fußballvereinen oder der Sozialarbeit engagieren. Es ging genau um die Frage: Fällt hier etwas auseinander?
Und?
Pfeffer: In den USA erschien im Jahr 2000 ein berühmtes Buch von Robert D. Putnam, das hieß Bowling Alone, also: alleine Kegeln. Der Politikwissenschaftler beschreibt darin unter anderem am Beispiel der Kegelclubs, wie gemeinschaftsstiftenden Institutionen allmählich aus dem amerikanischen Leben verschwinden. In meinen 19 Jahren in den USA habe ich es kaum anders erlebt: Es gibt dort zunehmend weniger Begegnungsorte, in denen sozialer Zusammenhalt gelebt wird. In Deutschland haben wir derzeit noch eine Vielzahl von Institutionen und Organisationen, die den Zusammenhalt befördern. Wir haben eine öffentliche Infrastruktur, wir haben Vereine – eine reiche Tradition die es zu bewahren gilt.
Das Verschwinden solcher Systeme wäre ein Frühwarnsignal?
Pfeffer: Absolut. Ich sehe es als ein deutliches Warnsignal, wenn unsere öffentliche Infrastruktur bröckelt, egal ob nun Schwimmbäder und Turnhallen, Vereinsheime und Sozialzentren, Kindergärten, Schulen oder Universitäten. In meiner eigenen Forschung unterscheide ich zwischen Privatvermögen und öffentlichem Vermögen. Und alles, was ich gerade beschrieben haben, diese Institutionen der Integration, gehören für mich zum öffentlichen Vermögen. Wir können uns fragen, wieviel Vermögen wir in privaten Händen akkumulieren lassen und wieviel Vermögen wir als öffentliches Vermögen hier in diesem Land halten wollen. Eine entsprechende Gewichtung wäre durch steuerliche Umverteilung machbar.
Viel Geld von Superreichen fließt auch zu guten Zwecken. Die Bereiche sind vielfältig: medizinische Forschung, Entwicklungshilfe, Bildungsprojekte. Sie selbst bauen mit Geld der Stone Stiftung in München ein Institut zu sozialer Ungleichheit auf.
Pfeffer Dass Vermögende in wohltätige Zwecke investieren, ist natürlich begrüßenswert. Man kann sich aber auch fragen, ob es nicht viele Aufgaben gibt, wo wir die Entscheidungsmacht nicht in den Händen von vermögenden Menschen belassen sollten. Warum sie nicht dem demokratischen Prozess zum Aufbau öffentlichen Vermögens und zur Ausgestaltung des Sozialstaates aussetzen?
„Für mich werden die erfolgreichen Gesellschaften diejenigen sein, denen es gelingt, das Vermögen als öffentliches Vermögen zu konzentrieren, in Institutionen, die allen zugänglich sind.“
Schätzzahlen zufolge wird Vermögen oder die Weitergabe von Vermögen effektiv mit drei Prozent besteuert wird, Arbeit mit 30 Prozent.
Pfeffer: Diese Ungleichbehandlung bei der Steuer besteht. Als Beispiel: Die Bemessungsgrenze bei der Vererbung von Firmen etwa liegt in Deutschland bei 26 Millionen Euro. Bis zu diesem Wert ist die Weitergabe an die nächste Generation unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. 26 Millionen, das sind nicht der kleine Bauernhof oder die Bäckerei von nebenan, auch nicht der Meisterbetrieb im Handwerk. Und wenn Sie ein Häuschen von ihrer verstorbenen Mutter erben und dort wohnen, behalten sie dieses Häuschen – ohne Erbschaftssteuer und ungeachtet der vielen Vorteile, die Sie aus diesem Hauseigentum schon zuvor hatten. Interessanterweise ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung eine andere. Da wird die Erbschaftssteuer oft als Todessteuer vermaledeit.
In Deutschland stehen wir jetzt vor einem bemerkenswerten Generationswechsel. Die Babyboomer-Generation geht in Rente und wird dann irgendwann ihr Vermögen vererben. Was bedeutet das für die Verteilung in Zukunft von Besitz?
Pfeffer: Wir stehen vor einem Vermögenstransfer, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Das ist natürlich auch die Dividende der langen Friedenszeit, in der Familien Vermögen akkumulieren konnten. Mit dem Ableben der Babyboomer-Generation wird dieses nun weitergegeben.
Das klingt nach einem Aber.
Pfeffer: Die Vermögensungleichheit allerdings hat sich schon lange vor dem Ableben der Eltern vererbt. Im Schnitt erhalten Sie eine Erbschaft in Deutschland, wenn sie 50 Jahre alt sind. Mit 50 haben Sie schon einen Großteil Ihres eigenen Vermögensaufbaus betrieben. Und genau dieser Vermögensaufbau wurde natürlich schon bevorteilt, wenn Sie aus einer wohlhabenden Familie kommen. Das heißt im Rückschluss: Wenn also ein Großteil des elterlichen Vermögens schon lange vor dem Erbfall seine Wirkung zeigt, werden Sie auch mit der Erbschaftssteuer nur einen kleinen Teil gegensteuern können. Eine frühere Besteuerung, zum Beispiel indem man die Vermögenssteuer wieder einführt, würde dem entgegenwirken. Dazu muss man noch sagen, dass die direkte Umverteilungswirkung auch bei der Vermögenssteuer, zumindest in der gewohnten Größenordnung, recht gering ausfiele. Allerdings würde sie für ein höheres Steueraufkommen sorgen, das sich für den Aufbau öffentlichen Vermögens nutzen ließe.
Kommen wir noch einmal zum Wohneigentum. Der Markt hat sich dramatisch verändert.
Pfeffer: Wohnen stellt eine der zentralen Dimensionen der sozialen Ungleichheiten dar. Das ist ein Trend in vielen Nationen. In den USA etwa gibt es auf dem Immobilienmarkt eine große Konzentrationsbewegung, und mit und in Folge der sogenannten Großen Rezession von 2008 hat die Ungleichheit auch im Hausvermögen dort noch einmal extrem zugenommen.
Mit Wohnimmobilien Monopoly spielen
Nähern wir uns in Städten, in denen der Immobilienmarkt hochkocht, wie München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, den Londoner Verhältnissen an, wo die Oligarchen dieser Welt längst mit Wohnimmobilien Monopoly spielen?
Pfeffer: Internationales Finanzkapital wird derzeit oft in Städten angelegt. Es gibt Daten zu kanadischen Städten, zum Beispiel für Vancouver, in denen gezeigt wurde, dass in der attraktiven Innenstadt viele Wohnungen gar keinen Elektrizitätsanschluss mehr haben. Sie wurden von globalen Supervermögenden aufgekauft, die dort ihr Geld parken. Da ist der Strom nicht mehr freigeschaltet, weil ohnehin niemand mehr dort wohnt. Das mögen besonders krasse Fälle sein. Doch auch einigen Großstädten in Deutschland könnten ähnliche Probleme bevorstehen.
Düstere Aussichten?
Pfeffer: In Deutschland gibt es immerhin eine Spezialität: Ein substanzieller Teil der Mietbevölkerung wohnt in Genossenschaftswohnungen. Wenn Sie das einem Amerikaner erzählen, würde der das für unmöglich halten. Im internationalen Vergleich gilt genossenschaftliches Wohnen als hochradikal. Wir haben also – genauso wie mit den deutschen Vereinen – Modelle, die der Marktkonzentration etwas entgegensetzen könnten. Solange wir noch in dieser Sozialisierung aufwachsen, in der wir integrative Strukturen und Institutionen haben, die in gewisser Weise dem Kapitalmarkt entzogen sind, haben wir Denkmodelle, auf die wir aufbauen können.

Kommen wir zur Abteilung Utopie: Welche Form der Vermögensverteilung würden sie denn als wirklich gerecht erachten?
Pfeffer: Heiße Frage. Ungleichheitsforschende haben oft sehr präzise Informationen zur Ungleichheit, aber nicht unbedingt eine durchdachte Einstellung zur Gleichheit. Für mich werden die erfolgreichen Gesellschaften diejenigen sein, denen es gelingt, das Vermögen als öffentliches Vermögen zu konzentrieren, in Institutionen, die allen zugänglich sind. Ungleichheit im Besitz gibt es in allen Gesellschaften. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die sich mit einer öffentlichen Infrastruktur um die Menschen so kümmert, dass möglichst alle die gleichen Chancen haben ein erfülltes Leben zu führen und ihr eigenes Potential zu erfüllen. In einer solche Gesellschaft ist es im Idealfall nicht mehr entscheidend, ob der eine noch ein paar Euro mehr hat.
Interview: Hubert Filser und Martin Thurau
Professor Dr. Fabian Pfeffer ist Inhaber des Lehrstuhls für Soziale Ungleichheit und Soziale Strukturen an der LMU und Gründungsdirektor des Munich International Stone Center for Inequality Research (ISI). Pfeffer, Jahrgang 1979, studierte Soziologie an der Universität zu Köln und an der University of Wisconsin-Madison (USA), wo er auch seinen Ph.D. machte. Danach lehrte und forschte er an der University of Michigan in Ann Arbor (USA). Dort baute er auch das Stone Center for Inequality Dynamics auf, bevor im Jahr 2023 an die LMU kam.




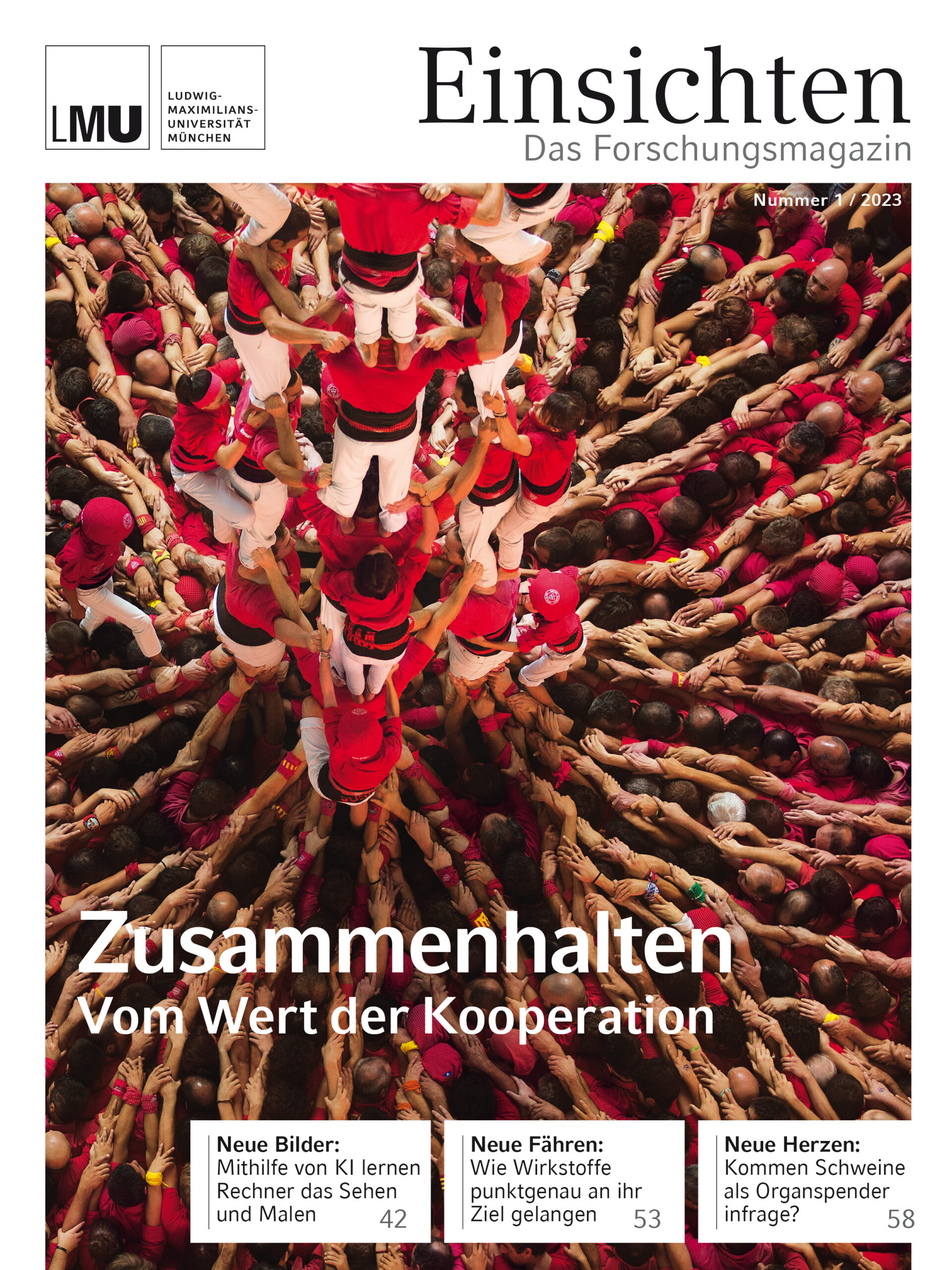
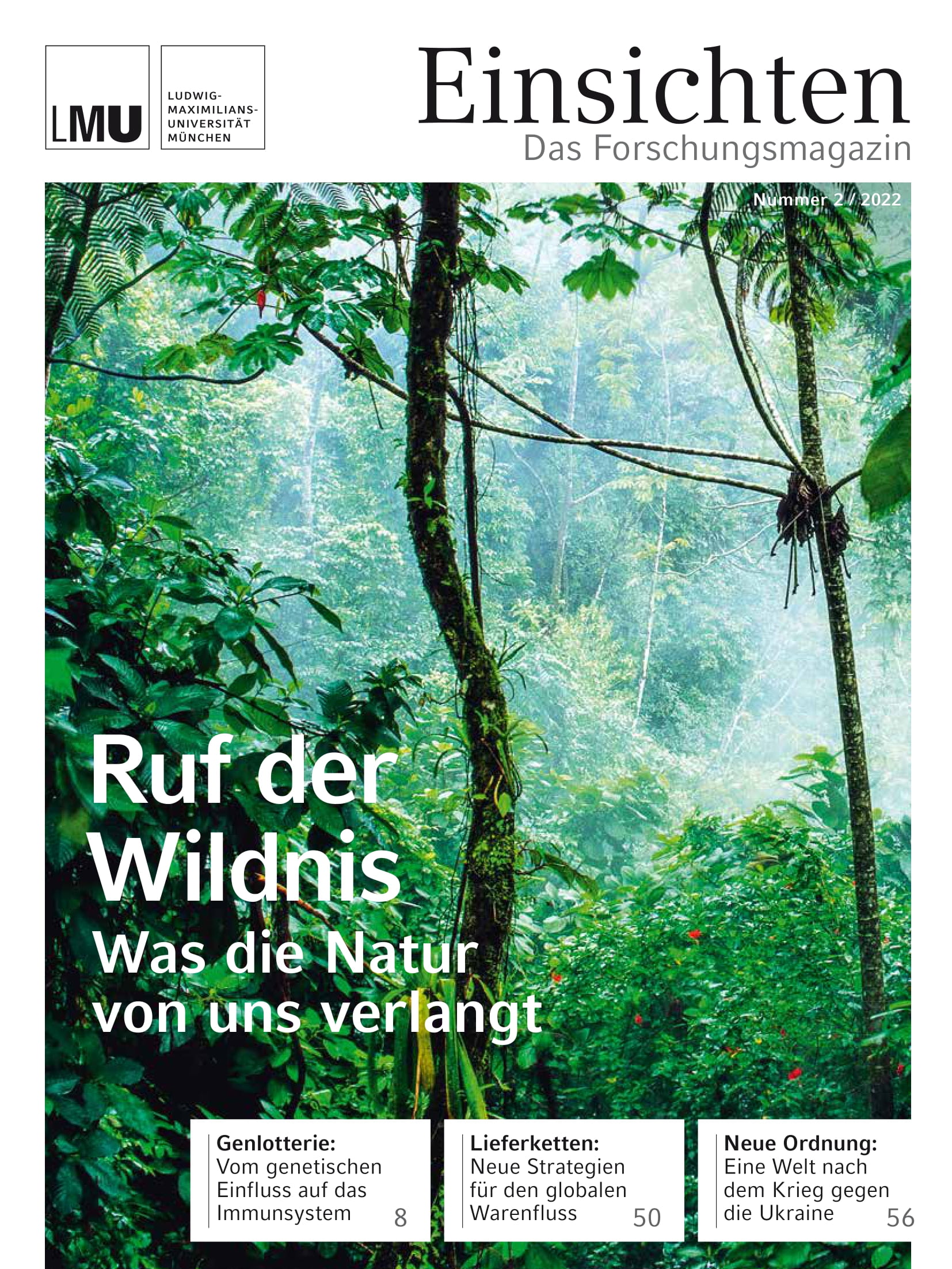
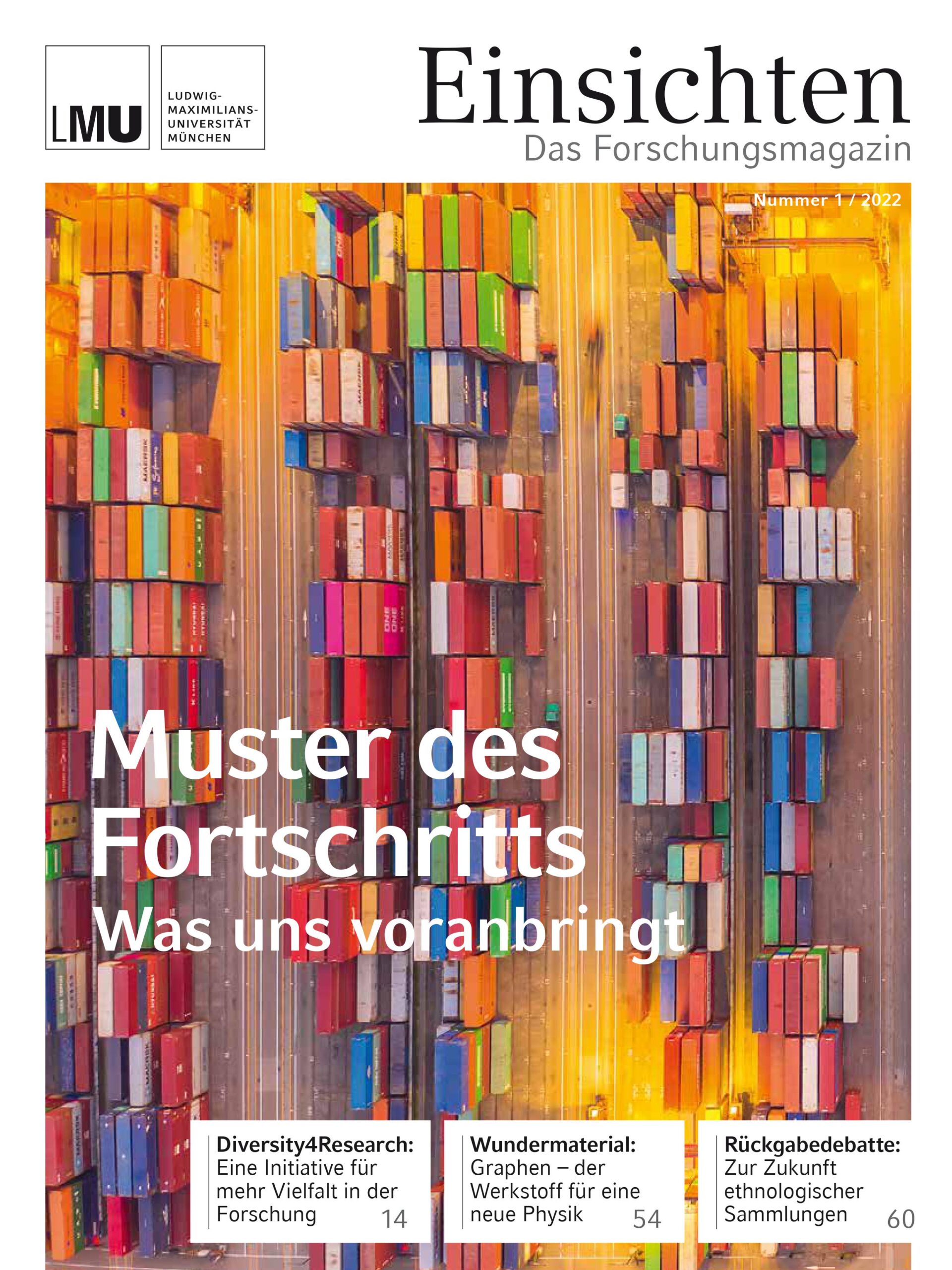
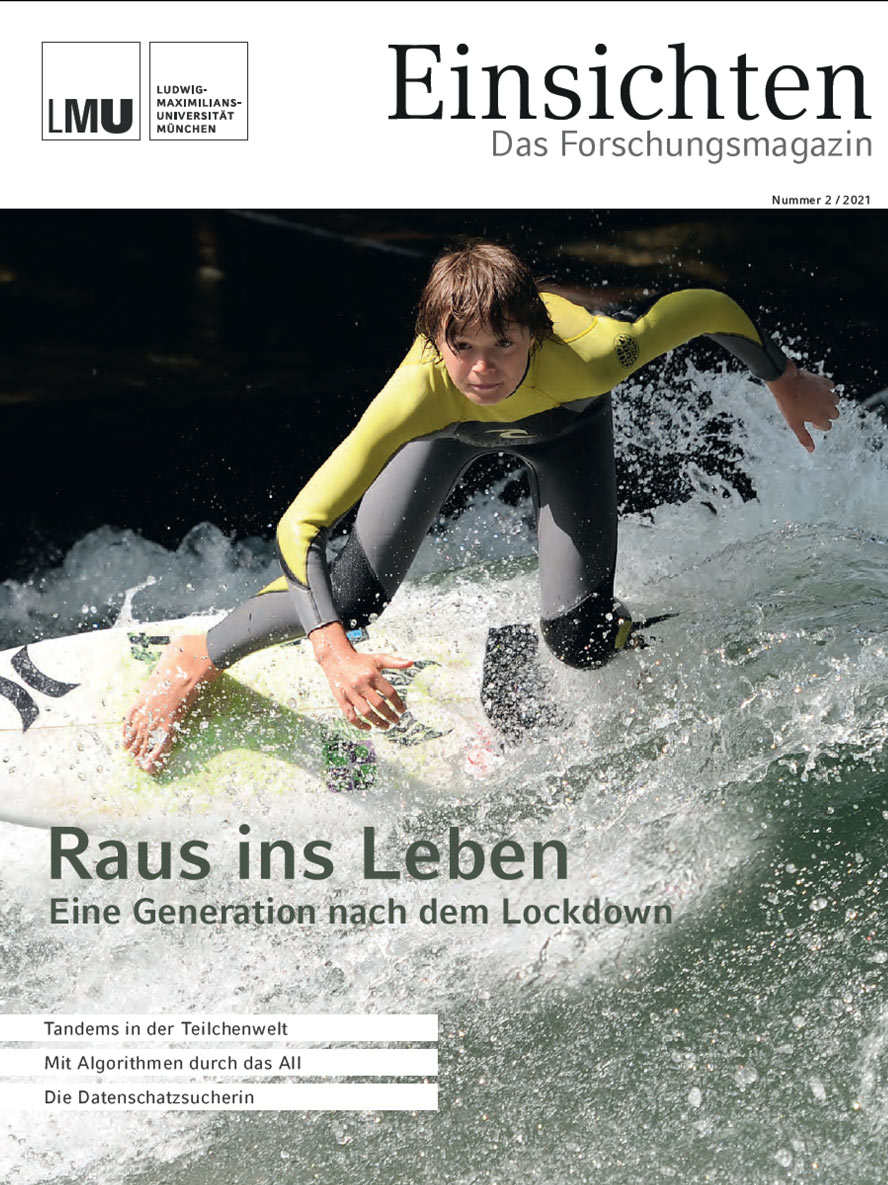



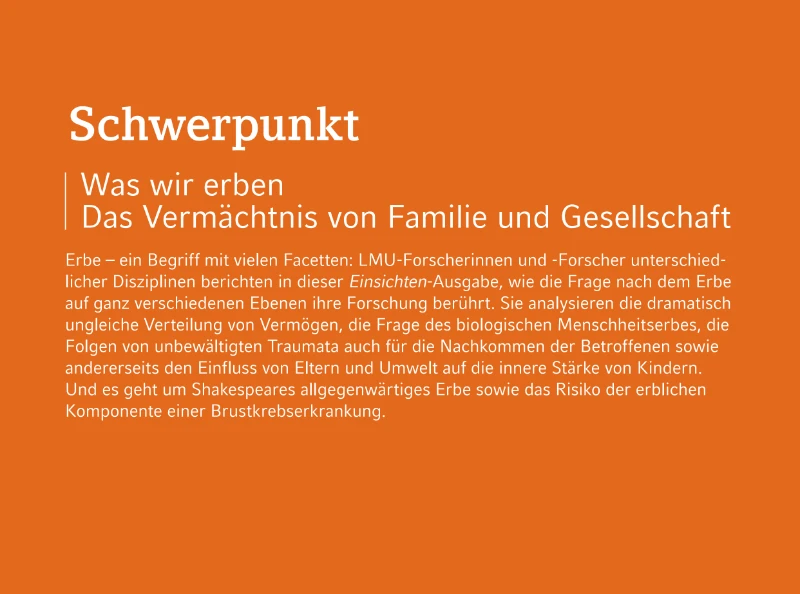



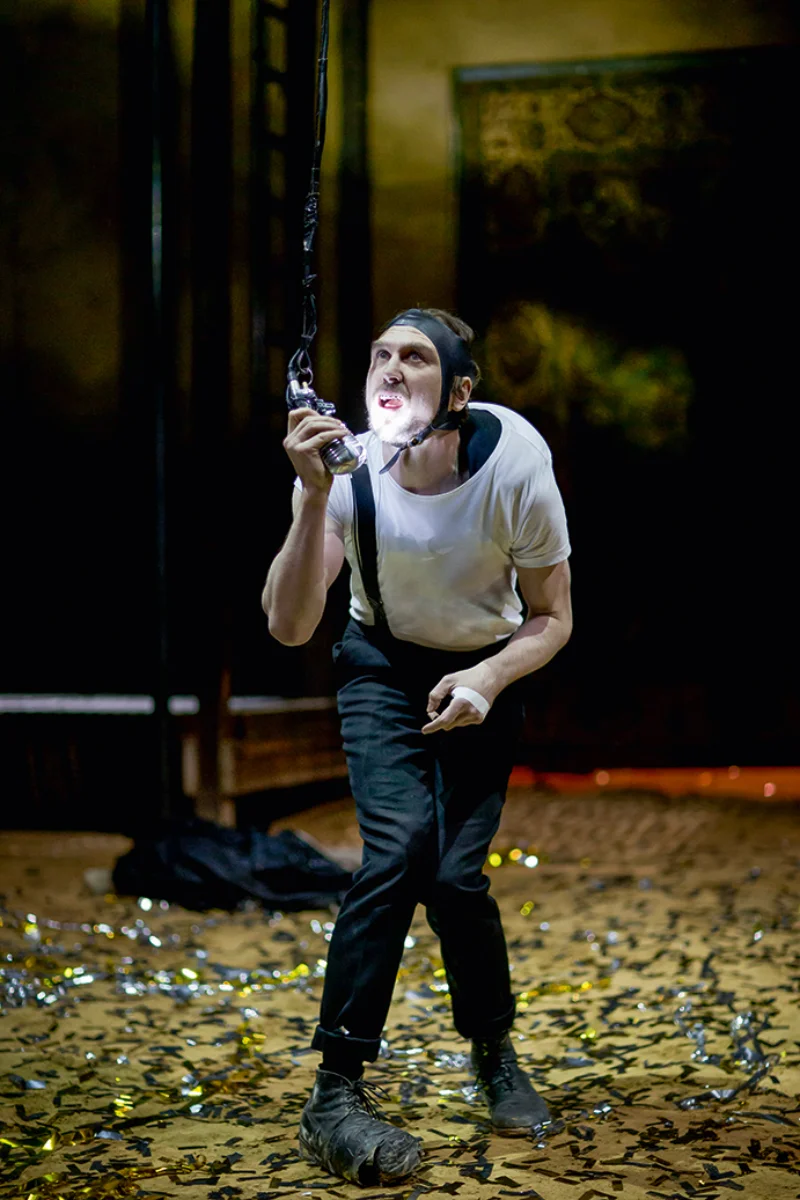




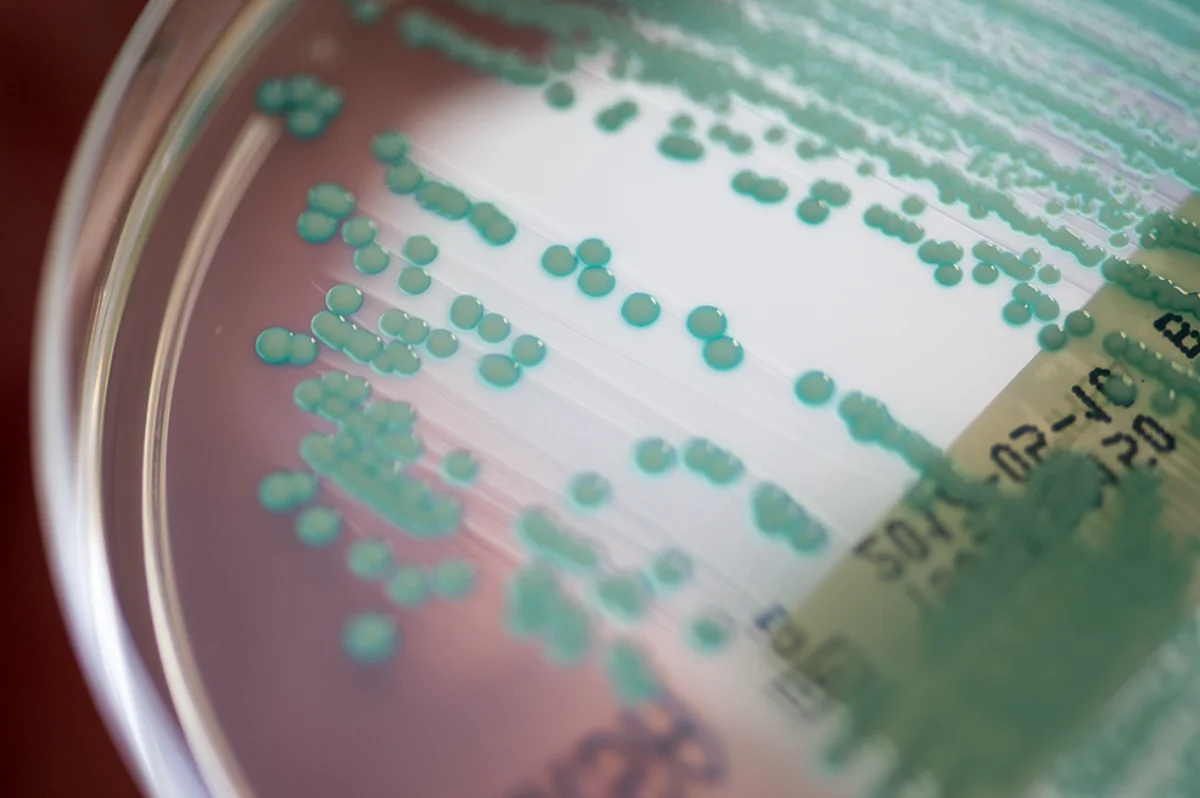
0 Kommentare