Traumtexter
Vor 100 Jahren veröffentlichte der französische Dichter André Breton das erste Manifest des Surrealismus. Es ging darum, die Welt anders zu sehen, ohne Kontrolle der Vernunft, dank „psychischen Automatismus“ und dem zweckfreien „Spiel des Denkens“. Künstlerinnen und Künstler wie Salvador Dali und Joan Miro zählten zur Gruppe. Bis heute dominieren in der öffentlichen Wahrnehmung die surrealistischen Werke der bildenden Kunst.
Welch zentrale Rolle auch Lyrik und Prosa für den Surrealismus spielten, zeigt der Literaturwissenschaftler Andreas Puff-Trojan in seiner Einführung. Viele Mitglieder der Bewegung schrieben Gedichte. Diese zeichnen sich durch „radikale“ Metaphern aus, die einander zu widersprechen scheinen, und den „Zusammenbruch des Intellekts“. „Traumtexte“ sollten das Unbewusste auf Papier bringen. Die Abgrenzung gegenüber Logik und vor allem den Konventionen des Bürgertums prägten Werk wie Leben der Gruppe. Frauen indes blieb die Rolle der Muse, als Künstlerinnen standen sie wie etwa Meret Oppenheim oder Leonora Carrington lange im Schatten. Inzwischen allerdings, so schreibt Puff-Trojan, nehme das historische Interesse an ihnen zu. (eins)
Andreas Puff-Trojan: Der Surrealismus. Kunst, Literatur, Leben. C.H.Beck Wissen, München 2024, 128 Seiten, 12 Euro
Experiment geblieben
Auch der Amerikanist Pierre-Héli Monot gräbt im Fundus von 100 Jahren Surrealismus, dieser Kreuzung von künstlerischer Avantgarde und bürgerlicher Aufbruchsbewegung. Monot aber, Fachmann für die politische Kultur von Pamphlet und Manifest, interessiert am Surrealismus vor allem die Politik, weniger die Kunst. Hundert Jahre Zärtlichkeit ist eine sehr subjektive Auseinandersetzung mit „Surrealismus, Bürgertum, Revolution“.
Ausgangspunkt von Monots Überlegungen ist ein Satz Bretons, wonach in der kapitalistischen Gesellschaft „die Hypokrisie und der Zynismus“ jedes Maß verloren hätten. Monot spiegelt die Kritik der Surrealisten, die Suche von Angehörigen des Bürgertums nach einer widerspruchsarmen antibürgerlichen Position und radikaler gesellschaftlicher Veränderung, an der Verfasstheit heutiger Gesellschaften. Der Essay sei, heißt es im Klappentext, „ein Buch über tiefe Krisen und überforderte Bürger“. Wäre die Bewegung nicht „schulisch, kunstgeschichtlich und politisch verschüttet“, meint Monot, könnte sie in der heutigen Konstellation als Stimme zählen. Seinerzeit „gescheitert“ sei sie indes „in der Normalisierung einer konsequenzreichen Bürgertumskritik“. (math)
Pierre-Héli Monot: Hundert Jahre Zärtlichkeit. Surrealismus, Bürgertum, Revolution: Matthes & Seitz, Berlin 2024, 199 Seiten, 20 Euro
Wir, das Betriebssytem
Die Kriege, das Klima, der Rechtsruck, die Migration – ohne Zweifel alles bedrängend und bedrohlich. Was können wir also dagegen tun? Schon das hält Armin Nassehi für die falsche Frage, denn darin zeige sich die „große Geste“, die gerne die Gesellschaft, besser noch die Menschheit zum Kollektivsubjekt macht, das sich ja dann doch, bitte sehr und bitte rasch, auf die Bewältigung der Krise verständigen müsse.
Das kann nicht gehen, warnt der Soziologe und erklärt, wie man „anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken“ könne. Ihn beschäftigt dabei nicht, nach welchem Programm sich eine Krise am besten entschärfen liefle. Ihn interessiert, „wie das Betriebssystem funktioniert, auf dem diese Programme laufen“, nach welchen Mustern also eine moderne Gesellschaft auf Krisen reagiert. Er zeichnet die Interessenkonflikte und Erkenntnisdefizite, die Gewöhnungseffekte, Routinen und Trägheitsmomente nach, die verhindern, dass aus einer komplexen Gesellschaft ein geeintes Wir wird. Er plädiert für die oft „belächelten“ kleinen Schritte. Sie seien „keine Schrumpfform“, sondern böten die Chance, gesellschaftliche Transformation „evolutiv“ abzusichern. (math)
Armin Nassehi: Kritik der großen Geste. Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken. Verlag C.H.Beck, München 2024, 224 Seiten, 18 Euro




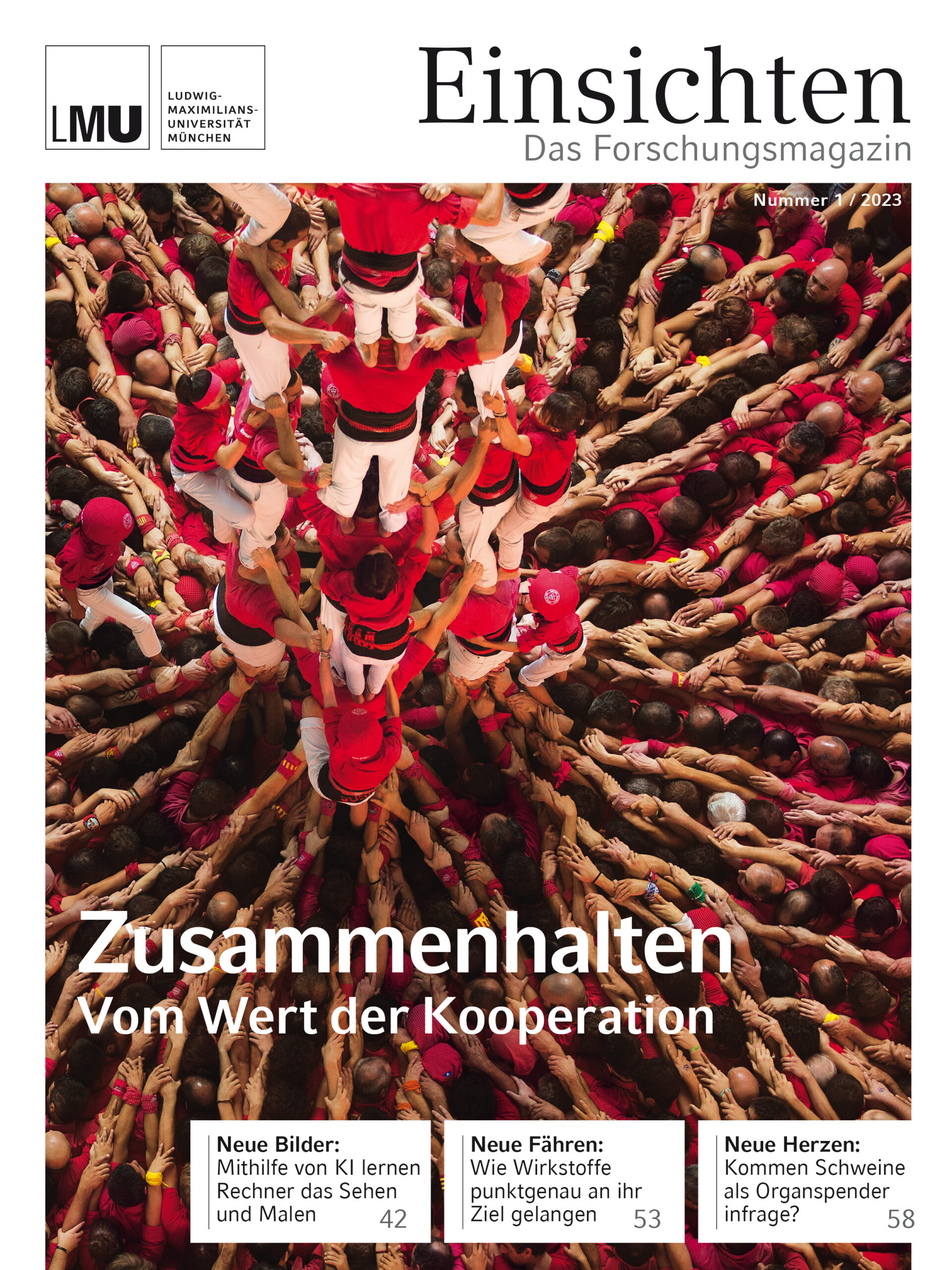
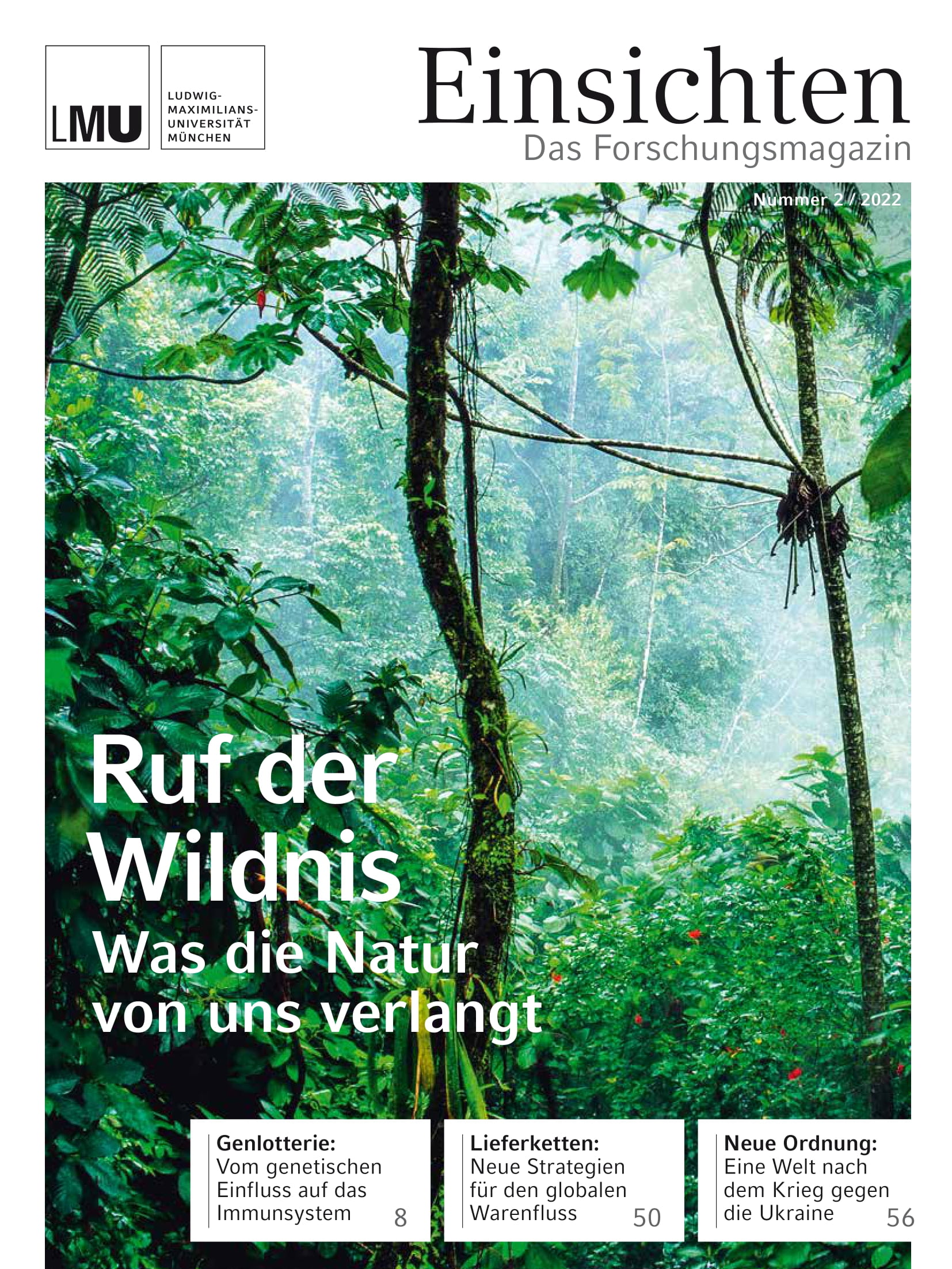
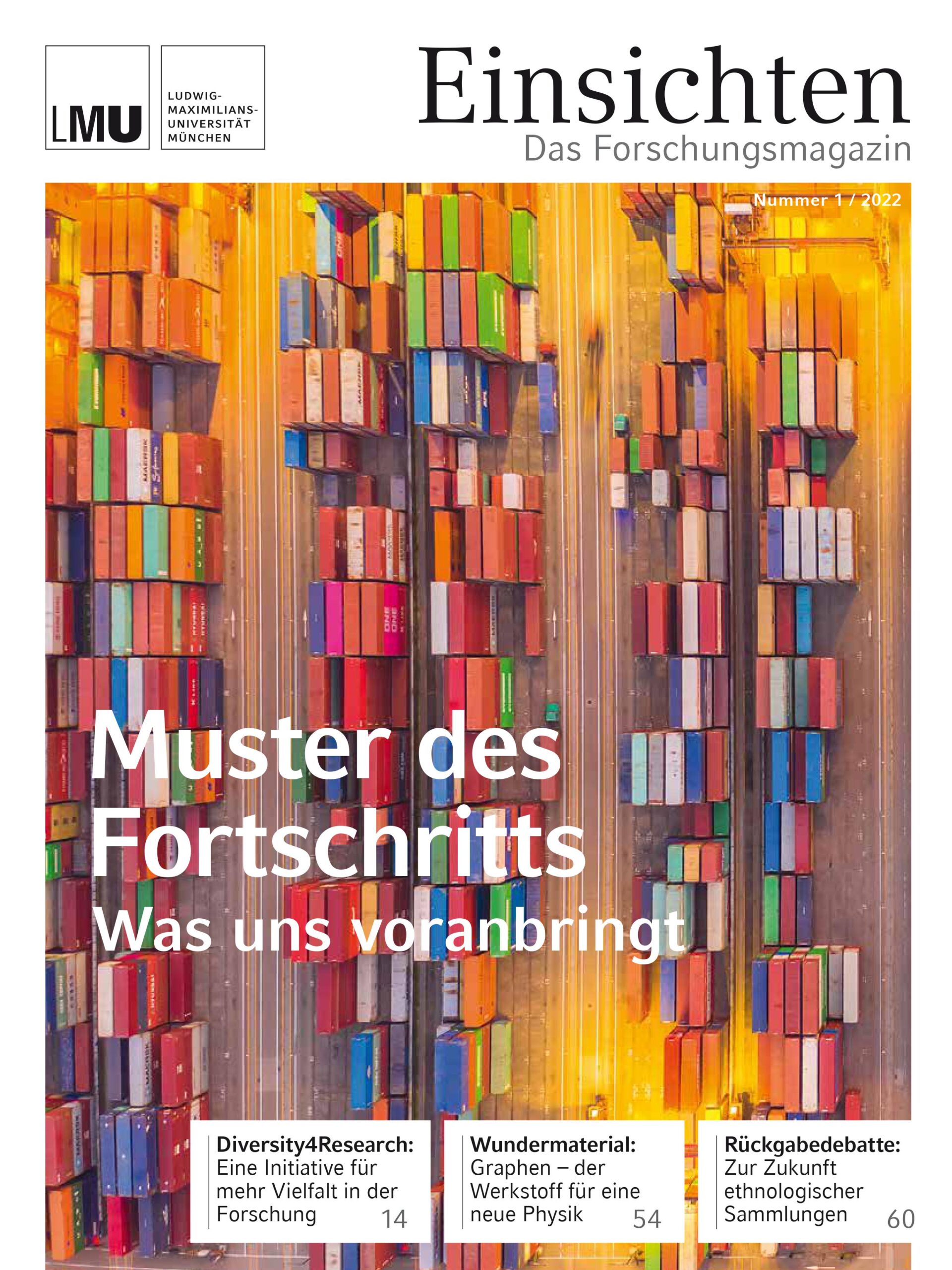
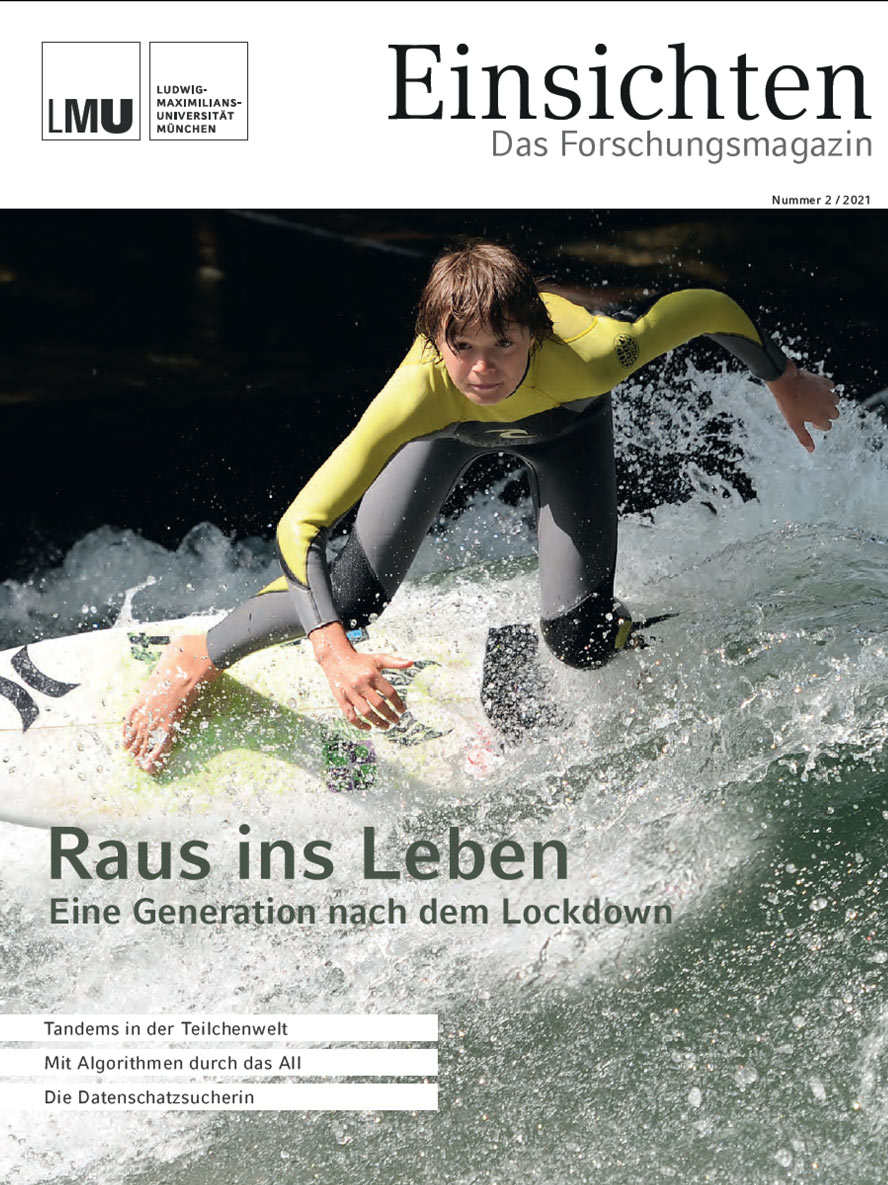



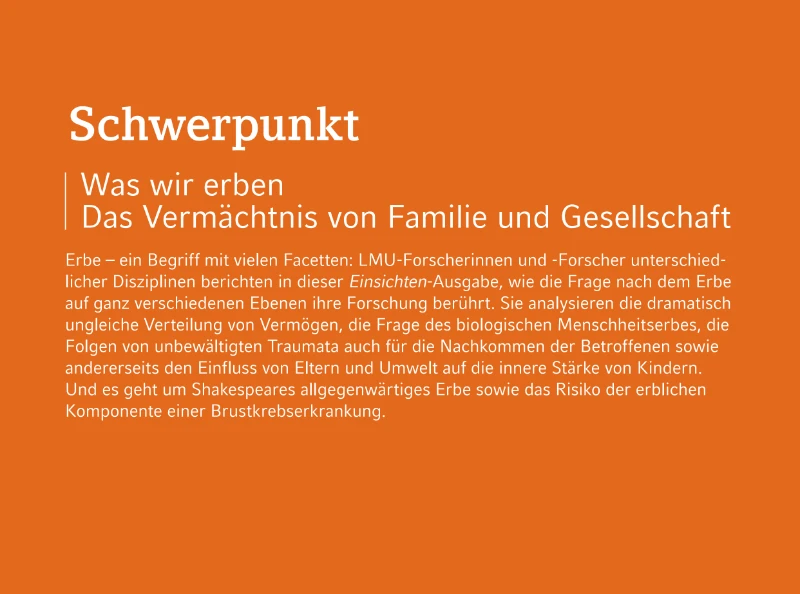




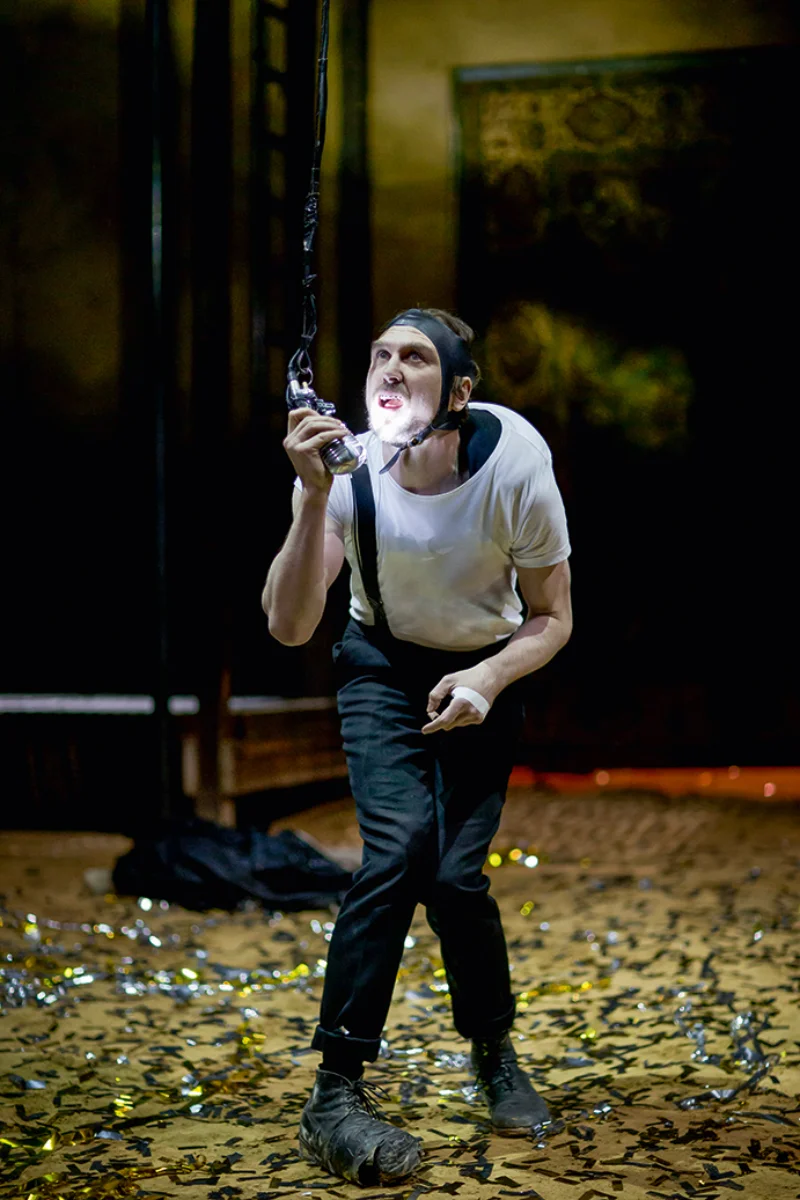



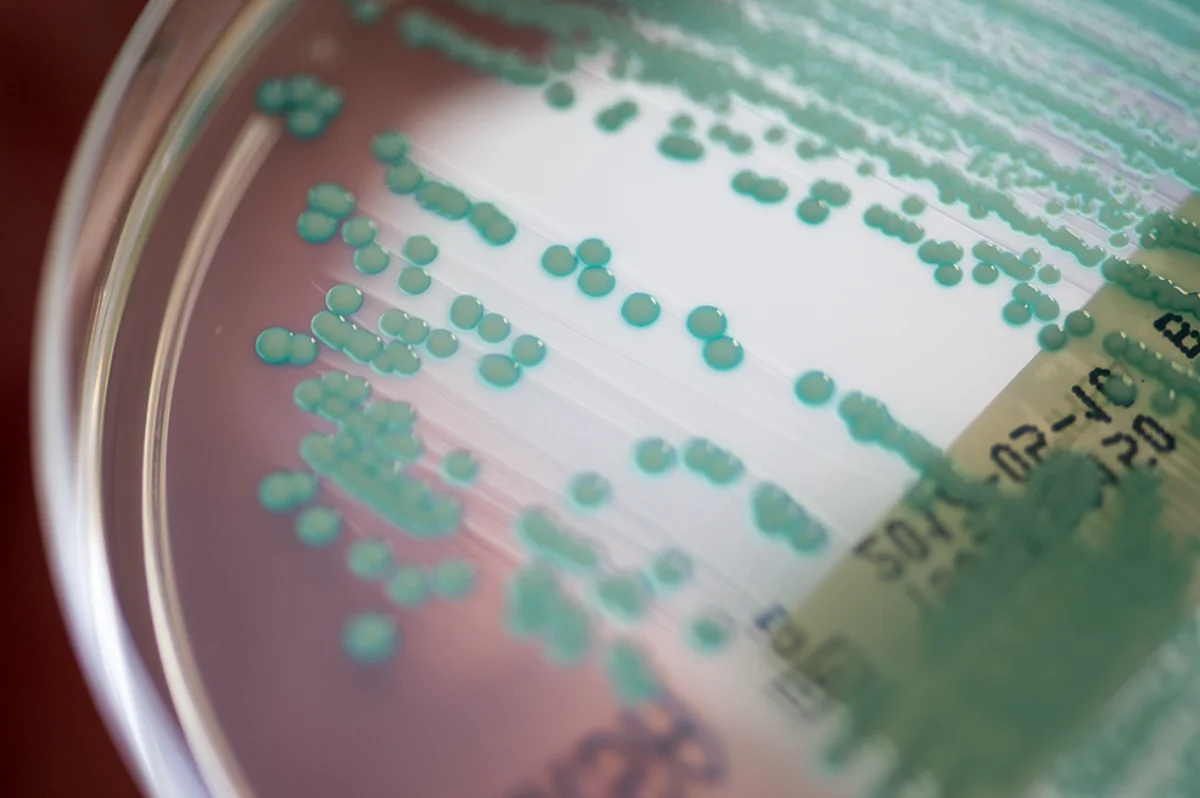
0 Kommentare