Exoplaneten sind eher scheue Gesellen. Allzu viel geben die fremden Welten nicht preis, wenn sie sich in der Umgebung weit entfernter Sterne verraten – entweder, weil die Planeten auf ihrer Umlaufbahn kurz das Licht ihres Heimatsterns verdecken oder weil sie so stark an ihm zerren, dass das Sternenlicht zu pulsieren scheint. Lediglich Größe, Masse und somit die Dichte der Exoplaneten können Astronomen aus solchen Beobachtungsdaten abschätzen. Mehr nicht.
Es gibt allerdings einen Trick, um weitere Details über die unscheinbaren Planeten zu erfahren: Sofern die fremden Welten, von denen Forschende inzwischen mehr als 5.600 Exemplare nachweisen konnten, über eine Gashülle verfügen, durchdringt ein winziger Teil des Sternenlichts auf seinem Weg zur Erde diese Atmosphäre. Unweigerlich hinterlassen die in der Hülle vorhandenen Moleküle im Sternenlicht dabei ihre chemischen Signaturen. Diese Spuren sind zwar schwach, Astronomen können sie heutzutage aber mit entsprechend leistungsfähigen Teleskopen aufspüren.
„Wenn wir mehr als Größe, Masse und Dichte wissen wollen, wenn wir etwas über die Chemie oder Biologie auf Exoplaneten erfahren möchten, dann ist die Atmosphäre unser Fenster dazu“, sagt Kevin Heng. „Lehrstuhlinhaber für Theoretische Astrophysik“ steht auf der Visitenkarte des gebürtigen Singapurers. Exoplanetenatmosphärenforscher wäre treffender: Heng, der seit August 2022 an der LMU lehrt und forscht, will mithilfe der Signaturen aus der Gashülle mehr über Exoplaneten erfahren: Wie haben sie sich gebildet? Was sind die Bedingungen vor Ort? Gibt es Hinweise auf geologische Aktivitäten oder sogar auf irgendeine Art von Biologie? Und, ganz oben auf der Liste: Sind wir allein im Kosmos? „Das Studium exoplanetarer Atmosphären ist vielleicht unsere beste Chance, fremdes Leben im Universum zu entdecken“, sagt Heng.
„Das Studium exoplanetarer Atmosphären ist wohl unsere beste Chance, fremdes Leben im Universum zu entdecken.“
Rund zwanzig Jahre ist es her, dass Forschende erstmals die Atmosphäre eines Exoplaneten entdeckten. Spuren von Natrium konnten sie damals nachweisen – ein für Biologie und Geologie eher nichtssagendes Element. Zwei Jahrzehnte später sieht die Welt anders aus. Insbesondere der Start des James-Webb-Weltraumteleskops im Dezember 2021, das tiefer und schärfer ins Universum blickt als alle Teleskope zuvor, hat dem Studium exoplanetarer Atmosphären einen Schub versetzt. Nachweise von Wasser, Sauerstoff, Methan, Kohlenstoffdioxid sind inzwischen zur Routine geworden. Und das Licht ist der Schlüssel dazu.
Licht ist der Schlüssel: Moleküle hinterlassen in der Atmosphäre ihre Spuren
Spektroskopie heißt die Technik, mit der sich eine Planetenatmosphäre auch in vielen Lichtjahren Entfernung untersuchen lässt: Jedes Molekül der planetaren Gashülle verschluckt das Licht des Heimatsterns bei ganz bestimmten Farben, Wellenlängen genannt. Wird dieses Sternenlicht von irdischen Teleskopen aufgefangen und wie ein Regenbogen in seine Bestandteile zerlegt – die Physik spricht von einem Spektrum – werden all diese dunklen Absorptionslinien sichtbar. „Jedes Molekül kann einen ganzen Wust solcher Linien erzeugen“, sagt Kevin Heng. „Sind die Beobachtungsdaten gut genug, ist das wie ein eindeutiger Fingerabdruck.“
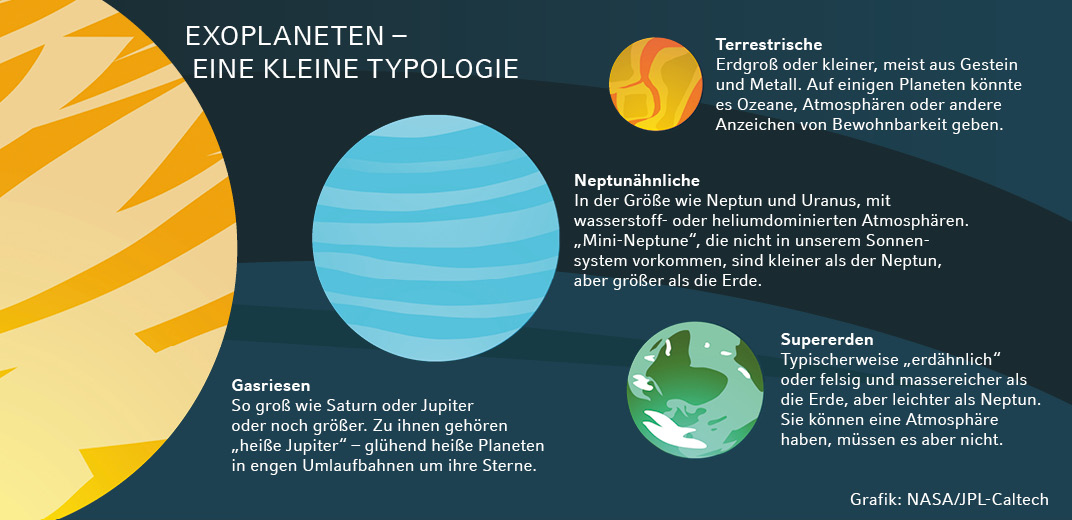
Soweit das Handwerk. Die Kunst oder – in Hengs Worten – die wissenschaftliche Herausforderung besteht nun darin, aus diesem Gewirr an Linien die richtigen Schlüsse über die geologischen, chemischen und biologischen Bedingungen vor Ort zu ziehen.
Das ist alles andere als einfach, denn viele Spuren, viele Fingerabdrücke, können in die Irre führen. Sauerstoff zum Beispiel gilt auf der Erde als klares Indiz für Leben. Auf einem wasserreichen Exoplaneten, der der harten ultravioletten Strahlung seines Heimatsterns ausgesetzt ist, könnte sich hingegen ein anderes Szenario abspielen: Das UV-Licht spaltet das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Die Anziehungskraft des Planeten reicht nicht aus, um den leichten Wasserstoff festzuhalten, er entweicht ins All. Zurück bleibt jede Menge Sauerstoff, dessen Fingerabdruck im Spektrum deutlich zu erkennen ist. Und trotzdem hat all das nichts mit organischen Verbindungen oder gar mit Leben zu tun. Gleiches gilt für Kohlendioxid: Auf der Erde ist das Gas vor allem biologischen Ursprungs, auf einem Exoplaneten ist es womöglich nur das Produkt von Vulkanismus.
Genau solche falschen Fährten will Kevin Heng mit seiner Arbeit aufdecken. Und er will wissen, welche Muster, welche Molekülspuren im Sternenlicht es braucht, um die exoplanetare Geochemie zu verstehen oder um sicher von biologischen Ursprüngen sprechen zu können. „Im aktuellen Stadium unserer Forschung ist es daher wichtig, so viele Moleküle wie möglich zu messen“, sagt der 45-Jährige. „Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche, bei der erst später klar werden wird, wie wertvoll der Schatz ist und was er uns verrät.“
Heng ist keiner jener theoretischen Physiker, wie sie in klischeebehafteten Lehrbüchern vorkommen mögen. Er ist niemand, der wochenlang mit Papier und Bleistift an seinem schlichten Holzschreibtisch sitzt und unentwegt Gleichungen löst. Er ist niemand, der den ganzen Tag grübelnd an die geflieste Rückwand seines Siebzigerjahre-Büros in der Münchner Universitäts-Sternwarte starrt. Dafür ist Heng viel zu umtriebig. Und dafür ist sein Forschungsgebiet, das in München nicht ohne Grund in den Exzellenzcluster Origins eingebunden ist, viel zu breit und viel zu interdisziplinär.
Lassen sich irdische Kreisläufe auf ferne Planeten übertragen?
Natürlich hat auch klassisches theoretisches Arbeiten seinen Part im Alltag von Heng. Da ist zum Beispiel die zentrale Frage, ob und wie sich Theorien, die für die Erde und für unser Sonnensystem entwickelt worden sind, überhaupt auf ferne Exoplaneten übertragen lassen. Der irdische Kohlenstoffkreislauf bestimmt beispielsweise, wie sich der Kohlendioxidanteil in der Erdatmosphäre langfristig entwickelt. Gilt so etwas auch für Exoplaneten? „Das ist noch alles andere als klar“, sagt Heng. „Die Frage, inwieweit sich fundamentale physikalische und chemische Prinzipien universell anwenden lassen, ist fürs Verständnis von Exoplaneten aber von entscheidender Bedeutung.“
Heng arbeitet hier gezielt im Labor mit Geochemikern zusammen. Eine der zentralen Fragen: Welche Gase werden freigesetzt, wenn Felsbrocken unterschiedlicher Zusammensetzung schmelzen? Und wie passt das zu den Fingerabdrücken felsiger Exoplaneten, die mit Teleskopen aufgefangen werden können? Experimente sollen darüber genaueren Aufschluss geben – und die Erkenntnisse wiederum in die Theorien und Simulationen einfließen.
Als Heng vor zehn Jahren anfing, sich mit Exoplaneten zu beschäftigen, damals noch an der Universität Bern, bestand einer seiner ersten Ansätze darin, für die Erde entwickelte Klimasimulationen auf ferne Planeten zu übertragen. Solche Berechnungen am Computer sind auch heute noch wichtig für Heng. So arbeiten er und sein Team auch in München am Lehrstuhl daran, Atmosphären- und Klimamodelle besser an neueste Messungen anzupassen.

Die Forschenden verwenden dabei auch echte Beobachtungsdaten. Etwa ein Dutzend Datensätze des James-Webb-Teleskops sind mittlerweile in München angekommen. Sie werden am Lehrstuhl analysiert, die spektralen Fingerabdrücke werden genommen und die Ergebnisse mit den theoretischen Modellen abgeglichen.
Heng, der als kleiner Junge Astronaut werden wollte, sich dann aber auf die Astrophysik besann, ist daher auch an Raumfahrtmissionen beteiligt – nicht als Instrumentenbauer, dafür ist er dann doch zu sehr Theoretiker, aber als Ideengeber. Für das europäische „Cheops“-Weltraumteleskop, das gezielt nach Exoplaneten sucht und dessen wissenschaftliche Leitung in Bern liegt, hat er das Beobachtungsprogramm mit entwickelt. Und wenn Europa Ende des Jahrzehnts mit „Ariel“ den nächsten Exoplanetenjäger startet, ist Heng auch wieder mit dabei. Auf seine Initiative hin hat sich die LMU dem wissenschaftlichen Konsortium der Raumfahrtmission angeschlossen. Heng sagt: „Wir wollen die LMU zu dem Ort in Deutschland machen, an dem die Spezialisten zur Auswertung der ,Ariel‘-Daten sitzen.“
Astronomen, die Spektren von Exoplaneten aufnehmen. Datenwissenschaftler, die Fingerabdrücke analysieren. Geologen, Klimaforscher und Chemiker, die Modelle aufstellen und verfeinern – die Arbeit am Lehrstuhl geht längst über klassische Astrophysik hinaus. Für Heng, dessen Doktorarbeit sich noch ganz traditionell um die Überreste explodierender Sterne drehte, ist das nichts Neues mehr. Als er anfing mit dem Studium von Exoplaneten, so erzählt er, habe er sich erst einmal Kenntnisse in Klima- und Atmosphärenforschung anlesen müssen. Und in München habe er direkt einen Geochemiker eingestellt. Die Beiden bringen sich nun gegenseitig die Finessen ihres jeweiligen Fachs bei – und die damit verbundene Sprache.
Offen sein für Wissen aus anderen Bereichen
„Man kann nicht nur Physiker sein, will man die Atmosphären von Exoplaneten verstehen“, sagt Heng. „Man muss offen sein für Wissen aus anderen Bereichen, und man muss einen Weg finden, mit Leuten aus diesen Disziplinen zu sprechen. Dafür habe ich viele Jahre gebraucht.“ Geholfen hat ihm sein voriger Job als Direktor des Center for Space and Habitability in Bern, einem interdisziplinären Forschungszentrum rund um die Suche nach Leben im Universum.
Hengs wichtigste Erkenntnis: Es reicht nicht, einfach nur Spitzenforschende aus verschiedenen Disziplinen in einem Raum zusammenzubringen, so toll deren Lebensläufe auch aussehen mögen. „Dann passiert, so meine Erfahrung, ziemlich genau nichts“, sagt Heng. Es brauche vielmehr die richtigen Leute mit den richtigen Persönlichkeiten: aufgeschlossen, kommunikationsfreudig, in der Lage, über die Grenzen des eigenen Fachgebiets hinweg zu diskutieren. „So etwas findet sich leider nicht im Lebenslauf, da ist immer ein bisschen Ausprobieren nötig.“
All das – die Interdisziplinarität und das gegenseitige Verständnis – wird noch wichtiger, wenn eines Tages verstärkt nach Leben auf Exoplaneten gesucht werden soll und somit auch die Biologie ins Spiel kommt. Denn noch ist völlig unklar, wie Leben auf anderen Welten aussehen könnte. Wie auf der Erde? Oder ganz anders? Und nach welchen Fingerabdrücken muss dann eigentlich gefahndet werden?
„Die Suche nach Leben ist natürlich das ultimative Ziel“, sagt Heng, warnt zugleich aber vor überzogenen Erwartungen. „Es wird wohl erst die nächste Generation von Teleskopen und Menschen sein, die diese Frage beantworten kann. Wichtig ist aber, dass wir nun die Grundlagen schaffen, um dorthin zu gelangen.“
Alexander Stirn
Prof. Dr. Kevin Heng ist Lehrstuhlinhaber für Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten an der LMU und Mitglied im Exzellenzcluster ORIGINS. Der aus Singapur stammende Forscher studierte Astrophysik in Colorado und wechselte dann an das legendäre Institute for Advanced Study der Princeton University. Danach leitete Heng, Jahrgang 1978, das Center for Space and Habitability der Universität Bern, bis er im Jahr 2022 an die LMU kam.
















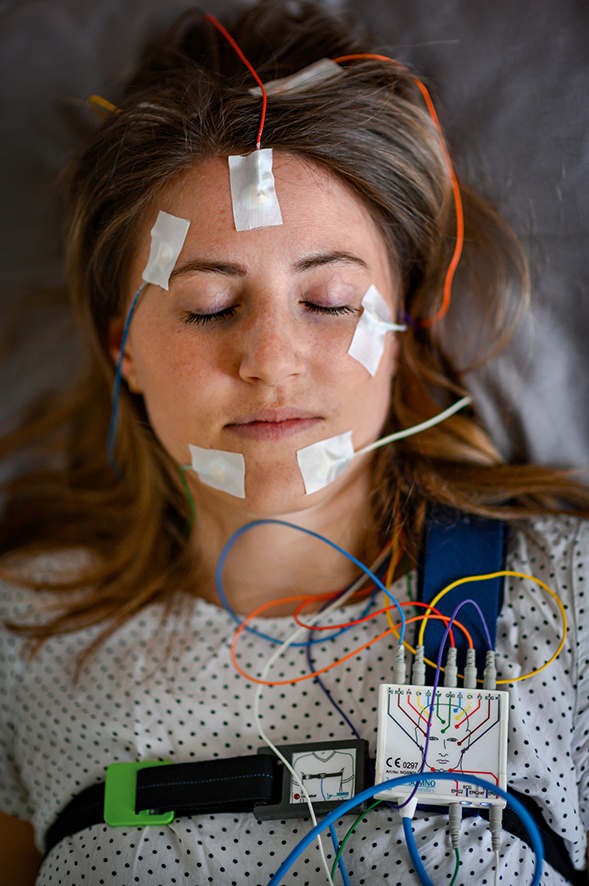






0 Kommentare